West-Nil-Virus: Bei Pferden und Wildvögeln nachgewiesen
Im August 2024 wies das Wildtierkompetenzzentrum im Lebensmittel- und Veterinärinstitut (LVI) in Hannover erstmals das West-Nil-Virus (WNV) bei einer Amsel aus dem Landkreis Gifhorn nach. Die positiv getestete Amsel wurde moribund, also sterbend, aufgefunden und verendete anschließend. Dies war der erste Fall, in dem das WNV bei Wildvögeln in Niedersachsen belegt wurde.
Zuvor wurde der Erreger in Niedersachsen 2020 und 2023 bei jeweils einem Pferd nachgewiesen. In beiden Fällen zeigten die Tiere neurologische Symptome. In 2024 gab es im LVI Braunschweig/Hannover insgesamt vier Nachweise bei Vögeln und 40 bei Pferden.
Aktuelle Informationen zur Lage finden sich auf tierseucheninfo.niedersachsen.de.
Untersuchungsmethoden des LAVES
Für die Diagnostik zum West-Nil-Virus stehen eine Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und zwei Antikörpernachweise (IgM- und IgG-ELISA) zur Verfügung. Zur Untersuchung von Pferden sollte eine Blutprobe (Serum und EDTA) an das Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover (Standort Hannover) des LAVES eingesandt werden. Alle positiven Ergebnisse werden vom nationalen Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Institutes bestätigt.
Rechtslage und Verbreitung
Das West-Nil-Fieber ist eine bei Pferden und Vögeln anzeigepflichtige Tierseuche und kann durch das West-Nil-Virus ausgelöst werden. Nach dem EU-Tiergesundheitsrechtsakt fällt die Seuche in die Kategorie E und muss innerhalb der Europäischen Union überwacht werden. Darüber hinaus sind keine weiteren tierseuchenrechtlichen Maßnahmen vorgeschrieben. In Deutschland wurden bislang einige Infektionen mit dem WNV bei Vögeln und Pferden diagnostiziert. Mittlerweile sind bis auf Bremen und das Saarland alle Bundesländer betroffen.
Wildvögel sind die Hauptwirte des Erregers. Stechmücken gelten als Überträger. In ihnen vermehrt sich der Erreger. Bei den meisten Vögel verläuft die Infektion subklinisch, das heißt sie ist schwer zu erkennen, oder führt lediglich zu milder Symptomatik. Insbesondere Sperlingsvögel, darunter vor allem Rabenvögel, aber auch Greifvögel- und Eulenarten sind hoch empfänglich für eine WNV-Infektion.
Beim West-Nil-Fieber der Pferde handelt es sich um eine Einzeltiererkrankung, sie gelten als Fehlwirte. Die Tiere zeigen bei einer Infektion selten starke klinische Krankheitserscheinungen. Nur bei einzelnen Tieren können neurologische Symptome wie zum Beispiel Stolpern, Nachhandlähmungen, Schwäche und Muskelzittern auftreten. In äußerst seltenen Fällen kommt es zu Todesfällen. Pferde gelten als „Fehlwirte“ und übertragen das Virus in der Regel nicht. Pferdehalter sollten die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) beachten und den Schutz der Tiere vor Mückenstichen intensivieren.
Übertragung auf den Menschen
Menschen können sich ebenfalls über Stechmücken mit dem West-Nil-Virus infizieren. Auch hier bleibt die Infektion in etwa 80 Prozent der Fälle völlig symptomlos. Wenn Krankheitssymptome auftreten, sind sie meist nur leicht ausgeprägt und grippeähnlich mit Fieber (daher stammt in Verbindung mit dem Ort erster Beobachtung der Name „West-Nil-Fieber“). Es kann jedoch in Einzelfällen zu schweren Verläufen mit hohem Fieber und Gehirn- beziehungsweise Hirnhautentzündung kommen, die unter Umständen auch bleibende neurologische Schäden nach sich ziehen. Bedingt durch den Klimawandel und die damit verbesserten Umweltbedingungen für Stechmücken haben Infektionen in Südeuropa kürzlich zugenommen.
Um das Infektionsrisiko mit dem West-Nil-Virus zu minimieren, bieten sich Maßnahmen zur Reduzierung von Mücken am Wohnort an. Dazu kann die Einschränkung von Brutmöglichkeiten beitragen. So können Wassertonnen oder andere offene Wasserstellen verschlossen, mit engmaschigen Netzen versehen oder ganz entfernt werden.

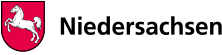

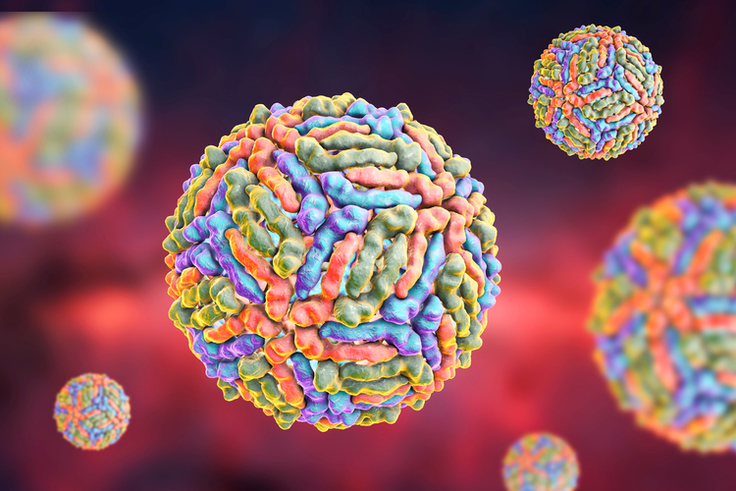

 English
English