Hier finden Sie das Dokument „Tierschutzleitlinie für die Schafhaltung“ zum Download
Tierschutzleitlinie für die Schafhaltung
Stand: September 2023
 Bildrechte: © LAVES
Bildrechte: © LAVESIn Niedersachsen liegen seit Mitte der 1990er Jahre die „Empfehlungen für die ganzjährige und saisonale Weidehaltung von Schafen“ vor, die neben dem Tierschutzgesetz, den allgemeinen Anforderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sowie den Europaratsempfehlungen für das Halten von Schafen zur Auslegung einer den Anforderungen des § 2 Tierschutzgesetz entsprechenden Schafhaltung herangezogen werden. Spezialrechtliche Mindestanforderungen für die Schafhaltung liegen auf Bundesebene bisher nicht vor.
Das überarbeitete Dokument liegt als „Tierschutzleitlinie für die Schafhaltung “ (PDF, nicht barrierefrei, Stand: 01.06.2023) vor. Gedruckte Broschüren sind über das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erhältlich (Homepage des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML)).
Neben Kapiteln zu Herdenschutz, Tierschutzindikatoren und Hitzestress sind unter anderem auch Mindestanforderungen an die Stallhaltung neu aufgenommen worden.

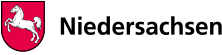

 English
English