Nachweise von Campylobacter in Geflügel beim Zoonosen-Monitoring
 Bildrechte: © contrastwerkstatt – stock.adobe.com
Bildrechte: © contrastwerkstatt – stock.adobe.comIm Rahmen des bundesweiten Zoonosen-Monitorings untersuchte das LAVES für Niedersachsen 1.253 Proben von Geflügel aus Schlachthöfen und 80 Proben aus dem Einzelhandel auf thermophile Campylobacter-Bakterien.
Insgesamt 58.808 Fälle von Campylobacteriose erfasste das Robert-Koch-Institut (RKI) im Jahr 2024. Damit liegt die von Campylobacter ausgelöste Krankheit in Deutschland deutlich auf Platz 1 der meldepflichtigen bakteriellen Erkrankungen. Die geschätzte Dunkelziffer liegt noch höher. Daran zeigt sich das beträchtliche Gefährdungspotenzial, das von den Erregern ausgeht. Deswegen gehört die Überprüfung von Geflügelfleisch auf die Bakterien fest zum bundesweiten Zoonose-Monitoring.
Für Niedersachsen überprüfte in 2024 das Lebensmittel- und Veterinärinstitut (LVI) Oldenburg 488 Proben von Masthähnchen aus Schlachthöfen. Davon stammten 300 Proben aus dem Blinddarm und 188 von der Halshaut. Hinzu kommen weitere 765 Proben von Puten aus Schlachthöfen, hier wurden 439 aus dem Blinddarm und 326 von der Halshaut entnommen.
Alle Proben teste das LVI Oldenburg qualitativ auf thermophile Campylobacter, schaute also nach, ob dort die Krankheitserreger vorkommen.
| Manche Arten von Campylobacter-Bakterien wachsen bei 42 Grad Celsius am besten. Deswegen bezeichnet man sie als thermophil, was so viel wie „Wärme liebend“ bedeutet. |
Zusätzlich wurden alle 514 Halshautproben quantitativ untersucht. Es wurde also festgestellt, wie hoch die Belastung mit Campylobacter-Bakterien war.
Untersuchungsergebnisse
Nachgewiesen wurden thermophile Campylobacter in 142 der 300 Blinddarmproben von Masthähnchen (47,3 Prozent) sowie 332 der 439 Blinddarmproben der Mastputen (75,6 Prozent). Für die Halshaut ergaben sich folgende Ergebnisse: 129 der 188 (68,6 Prozent) untersuchten Proben von Masthähnchen und 69 der 326 (21,2 Prozent) untersuchten Proben von Mastputen waren positiv. In den Proben von Masthähnchen wurden mehr Campylobacter jejuni-Isolate als Campylobacter coli-Isolate nachgewiesen. Das war ebenso bei den Halshautproben von Puten der Fall. In den Blinddarmproben von Puten überwog hingegen der Nachweis von Campylobacter coli.
Auf Ebene des Einzelhandels wurden in Niedersachsen 80 Proben Hähnchenfleisch ohne Haut qualitativ und quantitativ auf Campylobacter-Spezies untersucht, davon 32 Proben von Tieren aus ökologischer Haltung. Außerdem wurden 38 Proben Putenfleisch ohne Haut untersucht, ebenfalls qualitativ und quantitativ. Beim Putenfleisch wurde in nur einer Probe qualitativ Campylobacter jejuni nachgewiesen. Im konventionell erzeugten Hähnchenfleisch wurden in 18 von 48 Proben Campylobacter (37,5 Prozent) nachgewiesen, im ökologisch produzierten Fleisch in 19 von 32 Proben (59,3 Prozent).
Erkrankungssymptome
Zahlreiche Vertreter der Gattung Campylobacter können Erkrankungen bei Tieren oder Menschen auslösen. Das im Rahmen des Zoonosen-Monitorings vorwiegend nachgewiesene Campylobacter jejuni ist der häufigste Auslöser der menschlichen Campylobacteriose. Circa 80 Prozent dieser Erkrankungen beim Menschen werden auf diesen Mikroorganismus zurückgeführt. An zweiter Stelle folgen Campylobacter coli mit circa 15 Prozent. Infektionen beim Menschen verlaufen häufig symptomlos, im Falle einer Erkrankung zeigt sich fieberhafter Durchfall ohne Erbrechen für ein bis zwei Wochen.
In seltenen Fällen treten als Spätfolgen Erkrankungen wie Arthritis oder das Guillain-Barré-Syndrom auf.
Struktur des Zoonose-Monitorings
Für Niedersachsen misst das LAVES im Rahmen der bundesweiten Monitoringprogramme das bestehende zoonotische Potential bestimmter Bakterien oder anderer Zoonoseerreger in der Lebensmittelkette.
Die Messung basiert auf Programmen, die jährlich neu aufgelegt werden und alle Bereiche der Gewinnungskette von Lebensmitteln betreffen. Vorschläge dazu werden vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) erstellt und von den Bundesländern beschlossen. Es sind daneben auch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH), das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) und das Robert Koch Institut (RKI) berechtigt, Vorschläge zu machen. Die rechtliche Basis zum Zoonosen-Monitoring stellt die Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Erfassung, Auswertung und Veröffentlichung von Daten über das Auftreten von Zoonosen und Zoonoseerregern entlang der Lebensmittelkette dar (AVV Zoonosen Lebensmittelkette). Im Europarecht ist deren Grundlage wiederum in der Richtlinie 2003/99/EG zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern der Union zu finden.
Es werden grundsätzlich Lebensmittel tierischen und pflanzlichen Ursprungs einbezogen, ebenso Untersuchungen von Wildtieren. Diese Proben werden von den zuständigen Behörden der Landkreise und kreisfreien Städte erhoben. Um einen möglichst umfassenden Überblick zu erhalten, gehört darüber hinaus auch die Untersuchung von Futtermitteln zum Zoonosen-Monitoring. Diese Vorgaben werden von verschiedenen Organisationseinheiten des LAVES für Niedersachsen umgesetzt. Dies betrifft sowohl EDV-technische Voraussetzungen als auch die Planung und Untersuchung der Proben.

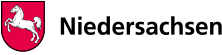




 English
English