Renaissance einer Tierseuche – Diagnostik und Fallbericht
Campylobacter-fetus-ssp.-venerealis-Infektion
Im Rahmen der Routineüberwachung von Besamungsstationen wurde Campylobacter fetus ssp. venerealis (Cfv) mehrfach isoliert. Es handelt sich dabei um den Erreger einer Deckseuche von Rindern. Der Nachweis dieser anzeigepflichtigen Tierseuche zieht drastische wirtschaftliche Beschränkungen nach sich, weil der Samen betroffener Tiere vernichtet werden muss und eine Freigabe für den Handel erst nach umfangreichen Kontrollen wieder möglich ist. Der relativ seltene Nachweis dieses anzeigepflichtigen Deckinfektionserregers von Rindern in der Vergangenheit und ein gehäufter Nachweis in relativ kurzem Zeitraum war Anlass für eine Diskussion über Herkunft und Nachweismöglichkeiten von Cfv.
Für den erfolgreichen Nachweis des Erregers wie auch dem Nachweis des Nichtvorhandenseins sind sorgfältige Probenentnahmen mittels Präputialspülprobe bei Deckbullen und Versand des Untersuchungsmaterials in einem geeigneten Transport- und Anreicherungsmedium unerlässliche Vorraussetzung. Im Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) wurden gute Erfahrungen mit dem „Medium nach Landers“ gesammelt (Empfehlung nach OIE).
Die Diagnostik im Labor durch kulturelle und molekularbiologische Verfahren erlaubt eine sichere Abgrenzung von harmlosen, aber sehr ähnlichen, häufiger vorkommenden Begleitkeimen. Mit den Primern MG3F und MG4R wird ein 764-bp-Amplikon bei nahe verwandten Erregern der Bakterienart C. fetus amplifiziert. Die Differenzierung der Unterarten erfolgt über das Primerpaar VenSF und VenSR, wobei nur bei C. fetus ssp. venerealis ein 142-bp-Amplikon erhalten wird.
Bereits die vorläufige Einordnung der Erregergruppe erfordert eine sorgfältige und aufwändige Diagnostik, wobei die Ausschaltung der umfangreichen Begleitflora von erheblicher Bedeutung und gleichzeitig auch ein Schwachpunkt im Untersuchungsverfahren ist. Erst nachdem der Erreger sozusagen von Begleitkeimen getrennt wurde, kann eine Differenzierung (Pyrosequenzierung, PCR) eingeleitet werden.
Die Infektionsquelle konnte trotz aufwändiger Verfahren nicht ermittelt werden, die Untersuchung führte aber zu der Erkenntnis, dass offensichtlich verschiedene Eintragsquellen (Zukauf?) in Betracht gezogen werden müssen. Die molekularbiologischen Differenzierungen (Pulsfeldgelelektrophorese, PFGE mit Sma I, Enzymverdau bei 25°C für 4 Std.) haben uns gezeigt, dass verschiedene Stämme Cfv am Infektionsgeschehen beteiligt waren. Die Infektion konnte bei den infizierten Deckbullen erfolgreich bekämpft werden, wie umfangreiche Nachuntersuchungen 2010 gezeigt haben, so dass bis zum heutigen Zeitpunkt der Erreger nicht mehr nachgewiesen wurde.
Kontrollstamm von Campylobacter venerealis - mikroskopisches Bild - Phasenkontrast
Artikel-Informationen
erstellt am:
22.03.2011
zuletzt aktualisiert am:
23.03.2011

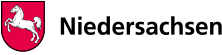


 English
English