Biosicherheitsmaßnahmen in Aquakulturbetrieben
Hinweise und Empfehlungen
 Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem Kleingeld
Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem KleingeldAb dem 21. April 2021 gelten die tierseuchenrechtlichen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/429 (Animal Health Law – AHL) sowie die entsprechenden Tertiärrechtsakte (Delegierte Verordnungen, Durchführungsverordnungen und Durchführungsbeschlüsse). Mehr Informationen gibt es im Infoschreiben des LAVES (PDF, nicht barrierefrei).
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) prüft aktuell die Konsistenz nationaler Vorschriften mit dem AHL. Das BMEL hat darauf hingewiesen, dass nach Geltungsbeginn des AHL das EU-Recht (AHL und Tertiärrechtsakte) das nationale Recht überlagert. Demzufolge dürfen gleichlautende oder entgegenstehende nationale Regelungen nicht mehr angewendet werden. Soweit das EU-Recht es zulässt, können die übrigen Regelungen angewendet werden.
Die nachfolgenden Hinweise mit Beispielen für Biosicherheitsmaßnahmen sollen eine Hilfestellung für Betreiber von Aquakulturanlagen sein. Werden im Folgenden die Begriffe „Fisch“ oder „Fische“ verwendet, umfassen diese auch Krebstiere und Weichtiere.
 Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem Kleingeld
Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem KleingeldI. Zukaufshygiene
Im Idealfall arbeitet ein Aquakulturbetrieb autark, das heißt er schließt eine eigene Laichfischhaltung mit ein. Ist jedoch aufgrund der Betriebsstruktur ein Zukauf von Fischen notwendig, sollten bereits im Vorfeld Informationen über den Hygienestandard und den Gesundheitsstatus der zu erwerbenden Fische eingeholt werden, um das Risiko einer möglichen Seucheneinschleppung zu minimieren.
Eine wichtige Hilfestellung für die Zukaufshygiene ist der sogenannte Gesundheitsstatus des Herkunftsbetriebes, die sich auf die gelisteten Wassertierseuchen der Kategorie C wie VHS, IHN, ISA und WSD bezieht:
- Status „Seuchenfrei“
- Status „Tilgungsprogramm“ zur Erlangung der Seuchenfreiheit
- Status „Freiwilliges Überwachungsprogramm für bestimmte Seuchen der Kategorie C“
- kein Status
Diese Kategorisierung dient dem Schutz des Gesundheitsstatus von Aquakulturbetrieben. Grundsätzlich sollten Fische nur in Betriebe mit gleichrangigem oder niedrigerem Gesundheitsstatus verbracht werden. Demnach dürfen Betriebe mit dem Status „Seuchenfrei“ Betriebe aller Kategorien beliefern, aber nur von anderen seuchenfreien Betrieben zukaufen.
Für den innerstaatlichen Handel zwischen Aquakulturbetrieben ist die Verwendung einer Eigenerklärung, zum Beispiel in Form des Anlagenpasses gemäß der Anlage 2 der FischSeuchV grundsätzlich zu empfehlen. Dieser Anlagepass umfasst unter anderem eine Gesundheitsbescheinigung, die bei einer Verbringung von Wassertieren in Betriebe mit Gesundheitsstatus verpflichtend ist. Bei Zukauf aus anderen Mitgliedstaaten der EU oder aus Drittländern sind Vorschriften über sogenannte TRACES-Mitteilungen und das Mitführen einer Veterinärbescheinigung zu beachten. Auskünfte dazu erteilen die zuständigen Veterinärämter.
Unabhängig vom jeweiligen Gesundheitskategorie ist es für den Empfänger aber grundsätzlich empfehlenswert, Informationen über den Gesundheitsstatus und die Gesundheitsfürsorge beim Herkunftsbetrieb zu erfragen. Es können gegebenenfalls auch Ankaufsuntersuchungen veranlasst werden. Auf die Transporthygiene ist ebenfalls zu achten, denn ungereinigte und nicht desinfizierte Transportfahrzeuge, Transportbehälter und Ausrüstung können unbelebte Vektoren (Überträger) für Krankheitserreger sein. Nach Anlieferung ist eine Kontrolle des Allgemeinbefindens und des Gesundheitszustands der Fische durchzuführen.
 Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem Kleingeld
Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem KleingeldII. Reinigung und Desinfektion
Auf Grundlage der „guten fachlichen Praxis“ sind Haltungseinrichtungen, Geräte und Verarbeitungsbereiche und gegebenenfalls auch befruchtete Eier regelmäßig zu desinfizieren. Für Transportvorrichtungen gilt, dass diese gemäß § 18 Absatz 3 FischSeuchV vor erneuter Benutzung gereinigt und desinfiziert werden müssen. Eine wirksame Desinfektion setzt zunächst eine gute Reinigung der Oberflächen voraus, denn Reste von Eiweiß oder eiweißhaltigem Material können die Wirksamkeit von chemischem Desinfektionsmittel stark beeinträchtigen. Nach dem Reinigen müssen die Flächen mit reichlich Wasser abgespült werden, da auch alkalische Reinigerreste die Desinfektionswirkung mindern. Die Wahl des geeigneten Desinfektionsmittels hängt unter anderem vom Erregerspektrum, der Jahreszeit und dem Einsatzbereich ab. Besonders in den Wintermonaten hat die Umgebungstemperatur für teichwirtschaftliche Betriebe einen entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels. Zum Beispiel bei Formaldehydhaltigen Desinfektionsmitteln ist der sogenannte „Kältefehler“ besonders ausgeprägt. Die Wirksamkeit ist bei Wassertemperaturen unter 10°C deutlich eingeschränkt. Weniger kälteanfällig sind zum Beispiel Wirkstoffe wie Peressigsäure oder organische Säuren.
Wichtig ist, dass nur Präparate zum Einsatz kommen, die über ein gesichertes Wirkungsspektrum gegen die jeweiligen Erreger verfügen. Daher sollten nur Desinfektionsmittel für die Geräte- und Flächendesinfektion verwendet werden, die eine Zulassung für den jeweiligen Anwendungsbereich gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozidverordnung) verfügen. Diese Produkte sind in der EU-Datenbank für Biozide oder national beim Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) bzw. in der DVG-Liste (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) aufgeführt. In großflächigen Karpfenteichwirtschaften können Desinfektionsmaßnahmen nur bedingt durchgeführt werden. Hier können neben der ordnungsgemäßen Reinigung und Desinfektion von Gerätschaften und Hälterungseinrichtungen auch Teichmanagementmaßnahmen wie das regelmäßige Abtragen von Teichsedimenten oder Schilfschnitte zur Biosicherheit beitragen.
Mehr Informationen zu dem Thema Reinigung und Desinfektion erhalten Sie in dem Artikel Hinweise und Empfehlungen zur Desinfektion in der Fischzucht.
 Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem Kleingeld
Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem KleingeldIII Betriebsmanagement
III.1 Bildung von epidemiologischen Einheiten
Um einer Verschleppung von Fischseuchenerregen innerhalb des Betriebes vorzubeugen, ist die Bildung möglichst vieler, in sich geschlossener und durch Hygieneschranken getrennter Bereiche sinnvoll. Nach dem Zukauf von Fischen und Eiern sollte diese im Bestand zunächst für zwei bis drei Wochen zu Beobachtungszwecken abgesondert werden. Dabei ist eine Absonderung am Ende der Wasserkette seuchenhygienisch sinnvoll. Der Personenverkehr sollte, sofern möglich, auf ein Minimum beschränkt werden. Karpfenteichwirtschaften verfügen im Vergleich zu Forellenbetriebe in der Regel über große Wasserflächen und liegen häufig in Erholungs- und Naturschutzgebieten, sodass durch Spaziergänger stets ein Personenverkehr besteht, der nicht verhindert werden kann. Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem Kleingeld
Bildrechte: © LAVES / Dr. Dirk Willem KleingeldIII.2 Schutzmaßnahmen gegen fischfressende Tiere und Schadnager
Fischfressende Vögel und Säugetiere können Vektoren darstellen, über die Fischseuchenerreger passiv übertragen werden können. Um dem entgegenzuwirken und um auch den Stress zu minimieren, der durch ein erhöhtes Aufkommen dieser Tiere bei den Fischen ausgelöst wird, sollten Aquakulturbetriebe bzw. deren Haltungseinrichtungen, sofern möglich, wirksam durch Überspannung, Einzäunung und/oder Einhäusung geschützt werden. In dem Zusammenhang wird auf die Informationen zur Überbespannung, Einhausung und Einzäunung von Teichen und anderen Anlagen zur Haltung von Tieren in Aquakultur verwiesen. Ein Runderlass des Nds. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (RdErl. d. ML v. 18. 5. 2017 – 204.1-42506-14 –– VORIS 78530) legt geeignete Maßnahmen zur Vergrämung von Fischprädatoren dar und enthält Empfehlungen für eine fachgerechte und ordnungsgemäße Überspannung, Einhausung und Einzäunung von Teichen und anderen Anlagen zur Haltung von Tieren in Aquakultur. Karpfenteiche stellen auch hier eine besondere Herausforderung dar, da sie aufgrund ihrer Fläche in der Regel nicht zu überspannen, einzuhausen oder einzuzäunen sind. Hier muss das Augenmerk vor allem auf, wenn rechtlich möglich, jagdlicher Vergrämung und der (vorgeschriebenen) betrieblichen Schadnagerbekämpfung liegen. Sogenannte „Teich-in Teich“ Systeme können für Karpfenteiche ebenfalls Schutz gegen Prädatoren bieten.
III.3 Ausbildung und Weiterbildung, Personalschulung
Es ist unerlässlich, dass sich der Tierhalter im Hinblick auf die Übertragbarkeit anzeigepflichtiger Wassertierseuchen sachkundig macht. In dem Zusammenhang muss er sich mit möglichen Wegen der Übertragung über empfängliche und Überträgerarten bzw. über passive Vektoren auseinandersetzen. Diese Verpflichtung nach dem TierGesG schließt neben einer fundierten Ausbildung auch die laufende Aktualisierung der Kenntnisse und Fähigkeiten durch Fortbildung ein. Auch das Personal sollte in Bezug auf Fischseuchen und ihre Übertragungswege sensibilisiert werden, um mögliche Symptome beziehungsweise Risiken schnell erkennen zu können.
III.4 Notfallplanung
Auch wenn das TierGesG nicht vorschreibt, wie eine innerbetriebliche Notfallplanung durchzuführen ist, wird eine schriftliche Fixierung eines entsprechenden Notfallplans für jeden Aquakulturbetrieb empfohlen. So kann gewährleistet werden, dass im Seuchenfall eine weitere Verschleppung so schnell wie möglich unterbunden werden kann. Der Notfallplan sollte Anweisungen an das Personal, Zugangsbeschränkungen, Maßnahmen zur Absonderung von Fischen und zur Entwesung, Reinigung und Desinfektion enthalten. Wichtige Kontaktdaten wie die der zuständigen Veterinärbehörde, des bestandsbetreuenden Tierarztes oder Fischgesundheitsdienstes und des VTN-Betriebs („TBA/Abdecker“) sollten gut zugänglich und in aktueller Fassung vorhanden sein.
III.5 Haltung
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine gründliche Teich- beziehungsweise Beckenpflege mit Blick auf die Biosicherheit wichtig ist. Dazu gehören neben regelmäßigem Entfernen von Teichsedimenten und Uferbewuchs auch eine bedarfsgerechte Fütterung und insbesondere das Vermeiden von Überbesatz. Verendete Fische sind zu schnell wie möglich aus den Haltungseinheiten zu entfernen, auf Krankheitsmerkmale zu prüfen und unschädlich zu beseitigen. Bei auffälligen Veränderungen des Verhaltens oder Aussehens der Fische im Bestand bedarf es der Ursachenkontrolle und ggf. der Konsultation eines Bestandstierarztes bzw. Fischgesundheitsdienstes. In dem Zusammenhang sei an die Verpflichtung des § 11 Absatz 8 des Tierschutzgesetzes erinnert, wonach Halter von Wirbeltieren zu Nutzzwecken betriebliche Eigenkontrollen durchzuführen haben, bei den geeignete tierbezogene Merkmale (Tierschutzindikatoren) zu erheben und zu bewerten sind.
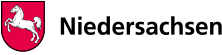

 English
English