
Wurstkonserven aus handwerklicher Herstellung
| Handwerkliche Fleischereien produzieren häufig auch Konserven, um ihr Sortiment zu bereichern. Daher findet sich in diesem Bereich ein breites Produktspektrum von vielen verschiedenen Herstellern. Im September und Oktober 2012 wurden im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg 138 Proben Wurstkonserven aus handwerklicher Herstellung in Niedersachsen untersucht. |
Ein Schwerpunkt der Untersuchung war die korrekte Einstufung der Produkte als Vollkonserve oder als Kesselkonserve, die mit unterschiedlichen Vorgaben zur Lagerungstemperatur und zur Mindesthaltbarkeitsdauer verbunden ist. Kesselkonserven werden bei der Herstellung weniger hoch erhitzt als Vollkonserven und bedürfen wegen der überlebenden Sporen mesophiler Bazillusarten einer Kühllagerung bei Temperaturen von maximal 10 °C. Bei ungekühlter Lagerung droht auf Grund der Vermehrungsmöglichkeit der Sporen der Verderb. Auf Kesselkonserven muss der Hersteller einen Kühlhinweis in Verbindung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum anbringen. Die Proben sind dann höchstens ein Jahr lagerungsfähig.
Die sichere Einteilung in Voll- oder Kesselkonserven ist nur anhand der Erhitzungsparameter bei der Herstellung möglich. Bei der mikrobiologischen Überprüfung von 33 ungekühlt gelagerten Proben wurden in sieben Proben vermehrungsfähige Mikroorganismen festgestellt. Diese Proben waren daher als kühlpflichtig einzustufen. Darüber hinaus war bei vier Proben das Haltbarkeitsdatum ohne Kühlung angegeben, obwohl es sich nach den Angaben zur Herstellungstechnologie um Kesselkonserven handelte. Zwei weitere Proben wurden ungekühlt angeboten, obwohl das Mindesthaltbarkeitsdatum mit einem Kühlhinweis versehen war. Es hat sich gezeigt, dass bei der Unterscheidung und richtigen Lagerung der verschiedenen Konservenarten bei den Herstellern nicht immer Klarheit herrscht.
Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen war die Zusammensetzung der Erzeugnisse. Bei 14 Proben wich diese von der allgemeinen Verkehrsauffassung ab: die Wurst enthielt zu viel Fett, Wasser oder Bindegewebe. In einer Sülze wurden Knochenpartikel gefunden. Auf 18 Dosen bzw. Gläsern wurden nicht zutreffende Angaben oder Bezeichnungen festgestellt. Hierzu einige Beispiele:
Zwei „Corned Beef“-Konserven enthielten Schweineprotein und Aspik und waren somit kein „Corned Beef“, was ausschließlich aus Rindfleisch hergestellt sein muss. Vielmehr handelte es sich um „Corned Beef in Gelee“ oder „Deutsches Corned Beef“. Ein „gekochtes Mett“ war gepökelt, obwohl Mett üblicherweise nicht gepökelt ist und es sich somit um eine „gekochte Mettwurst“ handelte. Eine „Hausmacher Leberwurst“ trug mehrere Etiketten mit unterschiedlichen Angaben der Bezeichnung, des Zutatenverzeichnisses und der notwendigen Lagerungstemperatur. Bei drei Proben war ein geringerer Fleischanteil enthalten als angegeben.
Als schwieriges Feld für die handwerklichen Hersteller stellt sich immer wieder die richtige Angabe der vorgeschriebenen Kennzeichnungselemente heraus, wie z. B. Zutatenverzeichnis, ausreichende Verkehrsbezeichnung, korrekte Angabe der Mindesthaltbarkeit, der Losnummer und der Füllmenge. Hier wurden die häufigsten Beanstandungen ausgesprochen. Bei 104 der 138 Proben wurden Kennzeichnungsmängel festgestellt. Hier einige Beispiele:
Zusatzstoffe wie Ascorbinsäure (E 300 / E 301; 18 Proben) oder Geschmacksverstärker (E 621; 3 Proben) fehlten im Zutatenverzeichnis sowie weitere Zutaten wie Fett, Wasser, Kochsalz oder Grütze (10 Proben). Häufig wurden Zutaten nicht mit der vollständigen Bezeichnung angegeben oder die Einzelzutaten von zusammengesetzten Bestandteilen fehlten. Die Mengenangabe von Zutaten, meist der Fleischanteil (sogenannte QUID), fehlte bei 14 Proben.
Senf ist ein häufig verwendetes Gewürz in Wurstwaren. Da Senf bei einigen Menschen eine Allergie auslösen kann, schreibt die Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung vor, Senf auch dann einzeln aufzuführen, wenn es z. B. als „Gewürz“ in Mischungen deklariert werden könnte. Bei acht Proben fehlte die Angabe von Senf auf dem Etikett, obwohl Senfkörner im Produkt sichtbar waren. Darüber hinaus wurden 118 Proben molekularbiologisch auf Erbmaterial (DNA) von Senf untersucht. Bei 67 Proben war der Test positiv. Da es sich um eine sehr empfindliche, qualitative Methode handelt, mit der auch geringste Spuren an Senf nachgewiesen werden, wurde den Überwachungsbehörden in diesen Fällen empfohlen, beim Hersteller zu überprüfen, ob Senf als Zutat verwendet wird und daher auf dem Etikett anzugeben ist.
Die Untersuchungen zeigten, dass in diesem Bereich auch in Zukunft Überwachungsbedarf besteht.

Wurstdosen

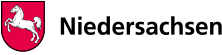

 English
English