 Bildrechte: Land Niedersachsen
Bildrechte: Land NiedersachsenLAVES veröffentlicht Jahresbericht 2006 - Minister Ehlen: 2,4 Mio. Untersuchungen Spitzenwert
Presseinformation Nr. 26 vom 23. August 2007
Verbraucherschutz hat in Niedersachsen höchste Priorität: "Mit rund 2,4 Millionen amtlichen Untersuchungen in 2006 hat das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit einen Spitzenwert erreicht (2005: 2,2 Mio, 2004: 1,6 Mio.), sagte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen während der Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des LAVES-Jahresberichtes 2006. Der Bericht wird in komprimierter Form präsentiert.
"Verbraucher müssen vor gesundheitlichen Risiken geschützt werden. Um dies zu gewährleisten, brauchen wir eine schlagkräftige amtliche Überwachung", so Ehlen weiter und nannte Zahlen: 43.646 Betriebe wurden von den kommunalen Überwachungsbehörden in Niedersachsen kontrolliert, jeder siebte Betrieb fiel bei amtlichen Kontrollen negativ auf (6.406). Zum Vergleich: Bundesweit waren knapp 600.000 Betriebe der Lebensmittelbranche unter die Lupe genommen worden, dabei wurden in rund 138.000 Betrieben Mängel entdeckt, also bei fast einem Viertel.
In Niedersachsen bezogen sich die meisten der Verstöße (5.227) auf mangelnde Hygiene.
Mit 2,4 Millionen Untersuchungen hat das LAVES einen Spitzenwert erreicht, aber es wird auch weitere Anforderungen geben: Durch das neue EU-Recht zur Lebensmittelsicherheit und -hygiene, das seit 2006 gilt, müssen auch in Niedersachsen deutlich mehr Betriebe besondere Vorgaben zur Gewährleistung der Sicherheit von Lebensmitteln erfüllen. Bisher registrierte Betriebe sind laut rechtlicher Vorgabe dazu verpflichtet, eine Zulassung zu beantragen. Besondere Beachtung verdient aus Sicht des LAVES die obligatorische Einführung einer Zulassungspflicht für alle Schlachtbetriebe und die schon bald in Kraft tretenden Regelungen zur Lebensmittelketteninformation. Damit werden Landwirte verpflichtet, umfassende Auskünfte zum Gesundheitsstatus der Tiere an einen Schlachtbetrieb zu vermitteln. "Hiermit wird eine wesentliche Informationslücke zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit geschlossen", sagt Dr. Eberhard Haunhorst, Präsident des LAVES.
Die neuen Verordnungen führen allerdings auch zu einem deutlich erhöhten Aufwand für das LAVES. Insbesondere wird zukünftig noch mehr als heute eine Spezialisierung der Sachverständigen auf die verschiedenartigen Lebensmittelbetriebe notwendig werden, um die kommunalen Veterinärbehörden und beteiligten Unternehmen kompetent zu beraten. Dem erhöhten Arbeitsanfall wird das LAVES durch die Einstellung fünf zusätzlicher Tierärzte im Laufe des Jahres 2007 Rechnung tragen. Damit werden auch Möglichkeiten geschaffen, den immer mehr an Bedeutung gewinnenden Export niedersächsischer Produkte in Länder außerhalb der Europäischen Union (z. B. USA) durch fachkundige Beratung interessierter Unternehmen zu stützen.
Im Europäischen Schnellwarnsystem lassen sich aktuelle Tendenzen zu speziellen Bereichen der LebensmitteIüberwachung, wie dem Import von Lebensmitteln, dem Auftreten von neuen Gefahren oder der Betroffenheit von bestimmten Lebensmitteln beobachten. Insgesamt gingen 2007 bereits 2.600 Meldungen ein (Stand: 1. August), davon betrafen etwa 10 % Deutschland und 114 Meldungen Niedersachsen.
Die niedersächsische Kontaktstelle im LAVES sichtet und filtert alle Meldungen, prüft also ob Niedersachsen betroffen ist und schickt die entsprechenden Meldungen gezielt den zuständigen Überwachungsbehörden zu.
Wie in den Jahren zuvor gab es die gleiche Tendenz von Produkten, die häufig Gegenstand der Meldungen waren: Aflatoxine in Pistazien, Erdnüssen oder Haselnüssen, nicht zugelassene Farbstoffe Sudan I in Gewürzen oder Salmonellen in Fleischprodukten. Aus Niedersachsen wurden Meldungen an das Bundesverbraucherministerium eingestellt, die u. a. Salmonellen in Rohwurst mit Truthahn, überhöhte Cumaringehalte in Frühstückscerealien mit Zimtgeschmack, nicht zugelassene gentechnisch veränderte Reisnudeln aus China oder nicht für den menschlichen Verzehr geeignetes Rindfleisch und Hähnchen-Döner aus Deutschland betrafen.
Fleisch- und Wurstwaren
2006 wurden im LAVES insgesamt knapp 4.500 Fleisch-, Fleischerzeugnisse sowie Wurstwaren als Planproben untersucht. Davon mussten 1.847 Proben beanstandet werden. Überwiegend handelte es sich bei den Beanstandungen um Kennzeichnungsmängel, oftmals fehlte die Angabe verarbeiteter Zusatzstoffe, bei Fertigpackungen fehlten Haltbarkeitsangaben, Mengenangaben und Nährwertangaben. Bei Überprüfungen der Haltbarkeitsdauer bei Fleischerzeugnissen in Fertigpackungen musste jede fünfte Probe beanstandet werden.
128 Proben Geflügelfleisch wurden auf Campylobacter untersucht, bei 41 % der Proben konnte ein Nachweis auf den Erreger erfolgen, der schon in geringsten Zahlen beim Menschen z. B. zu Erbrechen oder Durchfall führen kann, bei dem Erhitzen des Geflügelfleisches allerdings zerstört wird.
Zusätzlich zu den Planproben wurden von den Überwachungsbehörden Verdachts-, Beschwerde- und Verfolgsproben eingereicht. Es handelt sich um Verbraucherbeschwerden oder um aufgrund eines Verdachtes entnommene Proben. Von den 525 Fleischproben wurden 335 förmlich beanstandet, 8 als gesundheitsschädlich und 14 als gesundheitsgefährdend eingestuft. Der überwiegende Anteil mit 234 Proben war nicht zum Verzehr geeignet. Von den 122 eingereichten Wurstwaren wurden 55 beanstandet. Gesundheitsschädlich oder -gefährend war keine der Proben, als nicht sicher - zum Verzehr geeignet – wurden 14 Proben eingestuft, der höchste Anteil mit 30 Proben wurde als Wertminderung oder Irreführung eingestuft.
Salmonellen:
2006 wurden an den LAVES-Standorten insgesamt mehr als 23.000 Untersuchungen zum Nachweis von Salmonellen durchgeführt. Dabei wurden in 859 Fällen Salmonellen nachgewiesen, was einer durchschnittlichen Nachweisrate von 3,7 % entspricht.
Um eine verbesserte Lebensmittelqualität durch z. B. gesündere Tierbestände zu erreichen, werden EU-weit Monitoring-Programme durchgeführt. Dazu: 2006 wurden EU-weit durchgeführte Untersuchungen zum Nachweis der Verbreitung bei Broilern abgeschlossen. Nachdem im Jahr zuvor schon für Legehennen haltende Betriebe eine starke Belastung mit Salmonellen festgestellt wurde, konnte dies für Broiler bestätigt werden.
Die hohe Empfindlichkeit der Nachweisverfahren mit der Verwendung von Poolproben (zusammengefasste Proben von mehreren Tieren) trägt zur Verringerung von Untersuchungskosten bei.
Deutschlandweit wurden 3.941 Proben von Legehennen untersucht, davon waren 561 Proben mit Salmonellen belastet. Aus der geflügeldichten Region Weser-Ems stammten 609, untersucht, davon waren 116 mit Salmonellen belastet.
Broiler: Deutschlandweit wurden 1.892 Proben untersucht, davon waren 221 Proben mit Salmonellen belastet. In der geflügeldichten Weser-Ems-Region wurden 1.388 Broiler-Proben untersucht, davon enthielten 149 Proben Salmonellen. In Weser-Ems waren 43,5 % der Legehennenbetriebe und 17,3 % der Broiler-Betriebe mit Salmonellen belastet.
Wesentliche Elemente der Bekämpfung von Salmonellen in den Betrieben sind die konsequente Umsetzung bekannter Vorgaben zur Betriebshygiene und der Einsatz von Impfstoffen, um bei einem nicht immer zu vermeidenden Erregerkontakt eine Infektion und Ausbreitung im Bestand zu vermeiden. Niedrige Nachweisraten von Salmonellen in Zuchtgeflügelbeständen in den vergangenen Jahren zeigen, dass intensive Hygienemaßnahmen und Impfungen wesentlich zum Zurückdrängen von Salmonellen beigetragen haben.
Die Zahlen zu den Salmonellenausbrüchen beim Menschen zeigen die noch immer herausragende Bedeutung der Salmonellen, auch wenn konsequente Umsetzungen von Hygienemaßnahmen zu einer Verringerung führen könnten. Bei bestimmungsgemäßem, bzw. gebräuchlichem Verzehr von ausreichend erhitztem Geflügelfleisch besteht für den Verbraucher keine Gefahr (siehe Jahresbericht Seite 42 ff).
Salmonellennachweise gab es zudem in Futtermitteln: 297 Proben wurden untersucht, davon waren 17 proben positiv. Der Schwerpunkt der Nachweise lag wie in den Vorjahren bei eiweißreichen pflanzlichen Futtermitteln (Ölsaaten, Extraktionsschrote) und Fleischfressernahrung.
Salmonellen in Lebensmitteln: 2006 wurden 5.322 Salmonellenuntersuchungen durchgeführt, in 83 Proben wurden Salmonellen nachgewiesen. Der Hauptanteil, 74 Nachweise, entfielen auf die Produktgruppe Fleisch, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren (6-mal in Muscheln, 1-mal in Pilzen, 2-mal in Fertiggerichten). In 15 von 320 Planproben Hackfleisch vom Rind und/oder Schwein wurden Salmonellen nachgewiesen.
Pestiziduntersuchungen im LAVES:
Breiten Raum nehmen die Untersuchungen von Pflanzenschutzmittelrückständen im LAVES ein. Rund 450.000 untersuchte Parameter konnten für das Jahr 2006 im Lebensmittelinstitut Oldenburg des LAVES verzeichnet werden. Im ersten Halbjahr dieses Jahres erreichte die Zahl der untersuchten Parameter bereits eine Größenordnung von 250.000. In diesem Jahr wurden beispielsweise 124 Spargelproben auf Rückstände an Pestiziden untersucht; davon stammen rund 80 % aus Deutschland, die überwiegende Zahl der Proben hatte ihren Ursprung in Niedersachsen (71). 57 % der deutschen Proben wurden direkt beim Erzeuger genommen. Die restlichen Proben kamen aus Griechenland, Spanien, Marokko und Ungarn In 95 % der Proben (118) sind keine Rückstände gefunden worden. In den übrigen Proben fanden sich lediglich geringe Gehalte eines Wirkstoffes. Spargel ist im Allgemeinen sehr gering belastet, das zeigen ebenfalls die Werte aus den Vorjahren.
Die Ergebnisse der Rückstandsuntersuchungen von Gemüsepaprika haben gezeigt, dass die Anzahl der nachgewiesenen Wirkstoffe und die Anzahl an Proben mit Mehrfachrückständen stetig zugenommen hat. Insbesondere als Folge des Einsatzes neuerer und empfindlicherer Analysentechnik steigt der Anteil an Proben mit nachweisbaren Pestizidrückständen und ebenso die Anzahl der Wirkstoffe pro Probe. Auch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln hat sich gewandelt. Bei vielen Kulturen werden diese als Kombinationspräparate eingesetzt, das heißt, sie bestehen aus mehreren Wirkstoffen. Dies hat mehrere Gründe: Im Sinne des Pflanzenschutzes ist es notwendig, verschiedene Wirkstoffe gegen gleiche Krankheiten/Schaderreger einzusetzen, um Resistenzen zu vermeiden.
Dazu kommt, dass neuere Pestizide spezifischer wirken, das heißt, dasselbe Mittel wirkt nicht gegen verschiedene Krankheiten/Schaderreger, sondern nur gegen bestimmte Pflanzenkrankheiten. Treten gleichzeitig mehrere Erkrankungen auf, so werden verschiedene spezifische Wirkstoffe eingesetzt.
(Mehr im Jahresbericht, S. 62 f)
Schutz der ,,Kleinen Verbraucher" in Niedersachsen:
Säuglings- und Kleinkindernahrung im Test
Als Verbrauchergruppe sind Säuglinge und Kleinkinder ganz besonders schutzbedürftig, und daher sind Lebensmittelzusammensetzungen, die für sie bestimmt sind, auch außerordentlich streng geregelt. Im Lebensmittelinstitut Oldenburg des LAVES wurden 2006 352 Proben Säuglings- und Kleinkindernahrung untersucht. Davon wurden bei 204 Proben die Mineralstoffgehalte und bei 120 Proben Vitamingehalte überprüft. In rund 90 % der Fälle trafen die deklarierten Angaben zu. 23-mal (11 %) stimmten die deklarierten Mineralstoffgehalte sowie 12-mal die Vitamingehalte nicht mit den Angaben überein.
Problematischer waren dagegen Auslobungen, die wegen irreführender Werbung "Natriumreduziert" bzw. "Kochsalzreduziert" beanstandet wurden, da deren Natriumgehalte teilweise im Bereich der zulässigen Höchstmenge und damit für die Produktgruppe in einem hohen Bereich lagen. Die Bedingungen für solche Auslobungen sind jetzt durch das Inkrafttreten der Health-Claim-Verordnung (Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel) zum 1. Juli 2007 klar und neu geregelt.
Auffällig war die Werbung ,,Kristallzuckerfrei" für Produkte, die zwar keine Saccharose (Kristallzucker im engeren Sinne), jedoch hohe Mengen (z. B. über 40 % an Lactose) andere Zucker enthielten. Die neue Verordnung macht deutlich, dass diese Produkte keine Mono- und Disaccharide und auch keine süßenden Lebensmittel (z. B. "Traubenfruchtsüße") enthalten dürfen.
Cumarin: Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) sowie den kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehörden kurzfristig ein Untersuchungsprogramm hinsichtlich Cumarin in zimthaltigen Lebensmitteln vom LAVES organisiert und durchgeführt. Einige Zimtsorten enthalten den in der Pflanzenwelt weit verbreiteten natürlichen Aromastoff Cumarin. Zuvor hatten Toxikologische Untersuchungen und Bewertungen auf EU- und Bundesebene ergeben, dass bei übermäßiger Aufnahme von Cumarin eine leberschädigende Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Bei normalen Verzehrgewohnheiten wird die aus toxikologischer Sicht akzeptable tägliche Aufnahmemenge an Cumarin nicht überschritten. Diese Aufnahmemengen können jedoch bei Kindern aufgrund des geringeren Körpergewichtes überschritten werden.
Innerhalb kürzester Zeit wurden Probenahmen koordiniert und entsprechende laboranalytische Untersuchungskapazitäten aufgebaut. Bis Ende 2006 konnten in den LAVES-Instituten insgesamt 309 Lebensmittel auf deren Cumaringehalt untersucht werden, u. a. Backwaren, Milcherzeugnisse, Früchstückscerealien, Glühwein oder Kinderpunsch. Im Ergebnis wurden zehn Beanstandungen aufgrund erhöhter Gehalte ausgesprochen. Diese Lebensmittel wurden daraufhin sofort aus dem Handel genommen.
Die Untersuchungen in den LAVES-Instituten sind auch 2007 fortgesetzt worden. Über 50 Proben wurden bis Ende Juli untersucht, dabei musste eine Probe Honig mit zugesetztem Zimt aufgrund erhöhter Cumaringehalte beanstandet werden.
Zudem ist "Cumarin in Zimt und zimthaltigen Lebensmitteln" in 2007 Teil eines bundesweiten Überwachungsprogrammes. Dabei trägt Niedersachsen mit 140 Probenuntersuchungen in 2007 zu dem Programm bei und ist damit Spitzenreiter im Ländervergleich.
Weiterhin im Fokus: Gentechnisch veränderte Lebensmittel
2006 wurde bekannt, dass gentechnisch veränderter Reis aus USA und China exportiert worden war. In der EU dürfen nicht zugelassene gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel nicht vermarktet werden. Neben den Importkontrollen wurde EU-weit ebenso bereits auf dem Markt befindlicher Reis auf gentechnische Veränderungen hin untersucht. Die entsprechenden Untersuchungen werden in Niedersachsen vom Lebensmittelinstitut Braunschweig des LAVES durchgeführt. Hier wurde schnell reagiert und die vorhandenen Nachweisverfahren um die für diese gentechnisch veränderten Reislinien spezifischen Analyseverfahren erweitert. Über 200 Proben wurden untersucht, dabei konnte in acht Proben LL601-Reis (ursprüngliche Herkunft dieser GVO-Pflanze: USA) und in zwei Proben Bt63-Reis (ursprüngliche Herkunft: China) nachgewiesen. Noch vorhandene Lagerbestände dieser Erzeugnisse wurden daraufhin durch die Überwachungsbehörden bzw. Unternehmen vom Markt genommen.
Der Untersuchungsschwerpunkt Untersuchung von Reis(produkten) auf in der Europäischen Union nicht zugelassene gentechnisch veränderte Reislinien wurde auch 2007 fortgesetzt. Bis Ende Juli wurden 161 amtliche Lebensmittelproben aus Niedersachsen, zwei amtlich entnommene Futtermittelproben aus Niedersachsen sowie zwölf Lebensmittelproben aus dem Bundesland Bremen, für das die Untersuchungen auf Bestandteile aus gentechnisch veränderten Organismen auch im Lebensmittelinstitut Braunschweig des LAVES durchgeführt werden, untersucht.
In vier der 161 niedersächsischen Lebensmittelproben ließen sich Bestandteile aus gentechnisch veränderten Reislinien nachweisen, für deren Inverkehrbringen, Handel und Verkauf in der Europäischen Union keine Zulassung besteht. Bei drei (der vier positiven) Proben wurde gentechnisch veränderter Reis der Linie LL601 nachgewiesen (ursprüngliche Herkunft dieser GVO-Linie USA), in dem vierten Fall gentechnisch veränderter Reis der Linie Bt63 (ursprüngliche Herkunft der GVO-Linie: China).
Tiergesundheit
MKS:
Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche Anfang August 2007 in einem Betrieb in Großbritannien wurden routinemäßig alle Tierlieferungen, die von dort aus nach Niedersachsen gingen, ermittelt und überprüft. Betroffen waren zwei niedersächsische Betriebe, die vier, bzw. zwei Schafe aus einer Lieferung erhalten hatten. Die Tiere stammten allerdings nicht aus der Ausbruchsregion. Laboruntersuchungen im Friedrich-Löffler-Institut, Insel Riems, bestätigten, dass die Schafe nicht infiziert sind. Da der Erreger aber hochinfektiös ist und mit Transportfahrzeugen, Personen oder dem Wind übertragen werden kann, ist nach wie vor Wachsamkeit geboten. So werden derzeit alle Wiederkäuer mit MKS-ähnlichen, klinischen Symptomen vorsorglich auf MKS untersucht. Für einen tatsächlichen Krisenfall ist das Land Niedersachsen bestens vorbereitet: Die für die Bekämpfung vor Ort zuständigen kommunalen Veterinärbehörden haben sich auf einen Seuchenausbruch eingestellt. Die im LAVES eingerichtete Task-Force Veterinärwesen koordiniert als Teil des Landeskrisenzentrums die Krisenzentren auf Kreisebene und unterstützt die Veterinärbehörden bei den amtlichen Bekämpfungsmaßnahmen. Für "schwere Fälle" steht auch das mobile Seuchenbekämpfungszentrum (MBZ) der Länder, das aus 71 Containern besteht und in kurzer Zeit in ganz Deutschland aufgebaut werden kann, zur Verfügung.
Mitte Dezember 2006 wurde das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) in Barme, Landkreis Verden, offiziell eingeweiht. Vor dem Hintergrund der ständigen Bedrohung durch das Auftreten von Tierseuchen hatten die Bundesländer 2002 gemeinsam beschlossen, für die Tierseuchenbekämpfung ein MBZ anzuschaffen. Das MBZ ist durch seine Containerbauweise (71 Container) bundesweit schnell einsetzbar, wobei der Ab- und Aufbau durch das THW und durch die Containerfirmen durchgeführt wird. Neben der Krisenbewältigung ist es auch für praxisnahe Fortbildungen und Übungen hervorragend geeignet. Es verfügt über Büro-, Kommunikations-, und Hygieneeinheiten sowie über größere Mengen von Verbrauchsmaterial (z. B. Schutzkleidung, Probenentnahmesets oder Impfsets). Bei der zeitnahen Bewältigung eines größeren Seuchengeschehens besteht die Möglichkeit, durch das MBZ mit rund 300 bis 400 Personen zu arbeiten.
Geschäftsführendes Bundesland für das MBZ ist Niedersachsen. Das Niedersächsische Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat dabei viele Aufgaben dem LAVES (IuK-Technik, Recht und Task-Force Veterinärwesen) übertragen; die Behörde wurde mit der Beschaffung des MBZ beauftragt. Im Jahre 2006 bestand ein großer Teil der Arbeit für die Task-Force Veterinärwesen (Dezernat 32) des LAVES in der Koordination des MBZ-Projektes.
2007 fanden die ersten Schulungen und Übungen im MBZ statt.
Für die einzelnen Bundesländer, beginnend mit MVP, gefolgt von Sachsen, werden vom LAVES derzeit Informationsveranstaltungen durchgeführt. Weiterhin folgten eine Fortbildungsveranstaltung zur Tierseuche Schweinepest gem. Schweinehaltungshygieneverordnung für praktizierende Tierärzte sowie die Klausurtagung der Arbeitsgruppen des Tierseuchenbekämpfungshandbuches Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen. Im Juni führten auch die Tierseuchenreferenten der Länder eine Besprechung im MBZ durch und im Juli trafen sich dort die Landräte Niedersachsens.
Jede der Schulungen und Übungen transportiert das Ziel, im Falle eines Tierseuchenausbruchs eine Ausbreitung einer Tierseuche schnellstmöglich einzudämmen. Für September 2007 wird eine weitere, mehrtägige Tierseuchenübung derzeit vorbereitet.
Geflügelpest:
Die Bedrohung von Geflügelbeständen durch die mögliche Einschleppung der Aviären Influenza/HPAI aufgrund der weiterhin endemischen Situation in den asiatischen Ländern stellte sowohl für die Geflügelhalter als auch für die beteiligten Veterinärbehörden 2006 eine große Herausforderung dar. So wurden allein im Jahr 2006 im Land Niedersachsen über 20.000 Proben von den kommunalen Veterinärbehörden genommen und im LAVES serologische und virologische Untersuchungen durchgeführt. Darunter waren allein 9.000 Vögel, die im Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES auf den Erreger untersucht wurden. Aus zwei der von 6.000 von Wildvögeln stammenden Proben wurde das H5N1-Virus isoliert (Funde: LK Soltau-Fallingbostel; Stade). Dies waren die einzigen Fälle in Niedersachsen während des Geflügelpestgeschehens 2006 vorwiegend auf Rügen.
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Gefahr für die Geflügelbestände der EU findet auch in diesem Jahr in den Mitgliedsstaaten ein Geflügelpest-Monitoring bei Hausgeflügel und bei Wildvögeln statt. So wurden im Veterinärinstitut Oldenburg im ersten Halbjahr 2007 Proben von über 1.600 Vögeln untersucht.
Aufgrund der hohen Nachfrage richtete die Task-Force Veterinärwesen des LAVES 2006 den Verbrauchern zeitweise eine Telefon-Hotline ein, über 200 Telefonate pro Tag waren keine Seltenheit. Via Internet wurden die Geschehnisse für die Verbraucher ebenfalls laufend aktualisiert. Auch das Tierseuchenbekämpfungshandbuch Niedersachsen/Nordhrein-Westfalen, die internetbasierte gemeinsame Sammlung von Ablaufplänen, Vorlagen für Verwaltungsschreiben, Checklisten und Informationen für die Veterinärämter musste vielfach aktualisiert werden. Die Task-Force bot den für die Seuchenbekämpfung vor Ort zuständigen Landkreisen darüber hinaus vielfältige Unterstützung an (z. B. Erstellung von Restriktionszonen im Tierseuchenachrichtenprogramm), zudem fanden Informationsveranstaltungen und Schulungen statt.
Auch in 2007 sind vereinzelt Ausbrüche bei Wildvögeln in Bayern, Thürigen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu verzeichnen. Im Zusammenhang mit dem Wildvogelpestgeschehen hat es in Thüringen einen Ausbruch in einer kleinen Geflügelhaltung gegeben.
Blauzungenkrankheit:
Das Auftreten der Blauzungenkrankheit bei Rindern, Schafen und anderen Wiederkäuern stellt eine Herausforderung für die hiesige Tierseuchenbekämpfung dar, da diese bisher nur als exotische Tierseuche bekannt war, die ihr Verbreitungsgebiet weltweit hauptsächlich in den Tropen und Subtropen hatte, in Europa bislang nur in Süd- und Südosteuropa.
Für den Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich, auch findet keine Ansteckung von Tier zu Tier statt.
Die ersten Ausbrüche in Mitteleuropa wurden in den Niederlanden festgestellt, wobei ein Serotyp ermittelt wurde, der in Afrika vorkommt. Die Blauzungenkrankheit breitete sich in den folgenden Monaten langsam aus. Die Übertragung erfolgt durch stechende Mücken. Bekannte Überträger sind in erster Linie Gnitzen.
Unabdingbar für die Bekämpfung der Blauzungenkrankheit ist das Vorhandensein einer geeigneten Diagnostik, um ein infiziertes Tier sicher und endgültig zu erkennen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem hiesigen Auftreten der Blauzungenkrankheit wurden in den Veterinärinstituten Oldenburg und Hannover des LAVES in enger Kooperation mit dem Friedrich-Loeffler-Institut die Möglichkeiten zum Nachweis der entsprechenden Erregervariante und der entsprechenden Antikörper aus dem Blut infizierter Tiere geschaffen. Außerdem wurde der Erregernachweis aus Organproben verendeter Tiere etabliert. Bis zum Ende des Jahres 2006 konnten über 25.000 Blutproben auf Blauzungenkrankheitserreger und Antikörper in den Labors untersucht werden.
Auch in diesem Jahr wurden bis Ende Juli in den Veterinärinstituten Hannover und Oldenburg knapp 100.000 Untersuchungen durchgeführt, z. T. auch aus anderen Bundesländern (z. B. Thüringen).
Im November 2006 wurde der erste Fall in Niedersachsen im Veterinärinstitut Oldenburg des LAVES diagnostiziert und durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt. In 2007 ist bisher eine Neuinfektion in Niedersachsen festgestellt worden.
Um eine Ausbreitung der Seuche aus den betroffenen Gebieten zu vermeiden, ist das Verbringen von empfänglichen Tieren an strenge Auflagen geknüpft.
Hier übernahm das LAVES 2006 die Koordination der verwaltungsrechtlichen Aufgaben. Bei der fachlichen Beratung der Veterinärbehörden war der Fachbereich Schädlingsbekämpfung der Task-Force Veterinärwesen vielseitig gefragt (z. B. Gnitzen). Ein entsprechendes Monitoring wurde ins Leben gerufen, dessen Organisation in Niedersachsen der Task-Force des LAVES zufiel. Die Umsetzung erfolgt in den Landkreisen und kreisfreien Städten.
Tierschutz: Anfang Juni 2007 ist die Niedersächsische Tierschutzleitlinie zur Milchkuhhaltung herausgegeben worden. Anders als für Schweine, Legehennen und Kälber gibt es bislang keine detaillierten Haltungsanforderungen im EU-Recht bzw. in der nationalen Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Um tierschutzfachliche Anforderungen - wie angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung - an die Haltung von Milchkühen landeseinheitlich zu konkretisieren, hatte daher Niedersachsens Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Wissenschaft, der Veterinärbehörden, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und des Tierschutzbeirates des Landes unter Federführung des Tierschutzdienstes des LAVES einberufen.
Die im Juni herausgegebene Tierschutzleitlinie soll Behörden und Tierhaltern bei der tierschutzfachlichen Beurteilung sowohl von Neu- und Umbauten als auch von bestehenden Rinderhaltungen Hilfestellung geben. Die Leitlinien ermöglichen eine niedersachsenweit einheitliche Beurteilung von Milchkuhhaltungen durch die kommunalen Veterinärbehörden und geben Bauherren Sicherheit bei der Planung von Neubauten: Während für Neubauten entsprechende Mindestanforderungen zusammengestellt und darüber hinaus Empfehlungen für zusätzlichen "Kuhkomfort" gegeben werden, sind für Altbauten Richtwerte vorgesehen. In Niedersachsen halten ca. 15.000 Rinderhalter über 700.000 Milchkühe.
Neue EU-Tiertransportverordnung in Kraft:
Der Rat der EU hat 2004 eine Verordnung verabschiedet, die seit Januar 2007 gilt und den Schutz von Tieren beim Transport reglementiert. Dadurch sollen gleiche Tiertransportvorschriften in allen Mitgliedsstaaten der EU gelten. Verschärfte Anforderungen sollen dazu beitragen, dass sich Transportbedingungen für die Tiere verbessern. Bei der Frage, wie die Verordnung anzuwenden ist, zeigte sich im Vorfeld, dass noch viele Unklarheiten und Auslegungsschwierigkeiten auf EU-Ebene bestehen. Der Tierschutzdienst des LAVES hatte sich 2006 dieser Problematik angenommen und die im Land Niedersachsen aufgelaufenen und noch zu klärenden Fragen gemeinsam mit den kommunalen Veterinärbehörden zusammengetragen, um über das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium eine bundeseinheitliche Anwendung der Verordnung sicherzustellen. Dieser Fragenkatalog war auch Diskussionsgrundlage von Besprechungen der Länder in Deutschland. Derzeit werden unter Mitwirkung des LAVES Ausführungshinweise in Form eines Handbuches erarbeitet, das dann bundesweit angewendet werden soll.
Ausführungshinweise zur Schweinehaltung
Knapp ein Jahr ist es her, dass die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung um den Abschnitt "Anforderungen an das Halten von Schweinen" ergänzt und damit die jahrelange Diskussion um die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Schweinehaltung beendet wurde. Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben jedoch gezeigt, dass die Umsetzung der Bestimmungen in die Praxis viele Fragen aufwirft und mitunter auch zu unterschiedlichen Interpretationen führen kann. Anlass zur Diskussion geben insbesondere das geforderte Beschäftigungsmaterial für Schweine sowie die Lichteinfallsflächen bzw. die Beleuchtung bei Alt- und Neubauten. Um eine möglichst niedersachsenweit einheitliche Auslegung der Verordnung zu gewährleisten, hat das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Landwirtschaftskammer Niedersachsens, der kommunalen Veterinärbehörden und dem Tierschutzdienst des LAVES zur Erarbeitung eines Entwurfs von Auslegungshinweisen gegründet. Der Entwurf steht kurz vor dem Abschluss.
Tierschutzsymposium: Im Frühjahr fand in Oldenburg das 6. Niedersächsische Tierschutzsymposium mit zahlreichen Fachvorträgen und Betriebsbesichtigungen statt, das der Tierschutzdienst des LAVES organisiert hatte. Auch in diesem Jahr lag der Themenschwerpunkt im Bereich der Nutztierhaltung. So ging es bspw. bei der Rinderhaltung um die artgemäße Aufstallung von Ställen und um den Platzbedarf von Mastbullen, bei den Legehennen um den Bereich Ausläufe im Hinblick auf die Vermarktung von Freilandware. Ein weiterer Themenschwerpunkt lag auf der Haltung und Nutzung von Pferden. Haltungsanforderungen an die doch eher ,,exotischen" Alpakas schlugen den Bogen zum Heimtierbereich (z. B. Haltungsanforderungen an Papageienvögel). Über die Bundesgrenzen hinaus nahmen mehr als 150 Experten an der Veranstaltung teil.
Bienenvölker: Keine besonderen Verluste in Deutschland
Aufgrund des großen Interesses der Medien an den Bienenvölkerverlusten in den USA ist die Öffentlichkeit verstärkt auf das Thema aufmerksam geworden.
Bienenvölkerverluste sind u. a. aufgrund des daraus resultierenden Mangels an Bestäuberinsekten äußerst bedenklich. Nach Schätzungen werden 80 % der Blüten von Honigbienen bestäubt. Hierzu zählen auch sehr viele Pflanzen, die der Ernährung dienen.
US-Experten vermuten ein ungünstiges Zusammenspiel von Krankheiten, insbesondere Varroose inkl. Virosen als Sekundärerkrankungen, mangelhafte Wirksamkeit von Varroaziden aufgrund von Resistenzen, ungünstige Ernährungssituation mit Pollen im Herbst 2006, ungünstige Populationsentwicklung im Herbst 2006 bis zum Erreichen der kritischen Überwinterungsgröße und Managementprobleme insbesondere bei der Wanderung von Bienenvölkern.
Zur Situation in Niedersachsen und Deutschland: Bis auf einige Ausnahmen waren die deutschen Imker mit der Auswinterung ihrer Bienenvölker zufrieden. Eine Auswinterungsverlustrate von 10 % wird als normal betrachtet. Im Frühjahr 2003 lag die Verlustrate in Deutschland bei ca. knapp 30 %. Derzeit gehen die LAVES-Experten von deutlich unter 10 % bundesweit aus.
Allerdings hat sich die Situation im Laufe des Sommers verschlechtert. Das Bienenjahr 2007 wird als ein sehr frühes und schnelles Bienenjahr in Erinnerung bleiben. Rund drei Wochen Witterungsvorsprung haben über die ganze Saison auch zu einem entsprechend früheren Trachtspektrum geführt. Die Bienenvölker, aber auch die Varroen haben sich dieser Entwicklung angepasst. Sehr frühzeitig ist das Nahrungsangebot des Sommers zurückgegangen und teilweise nahezu erloschen. In den Bienenvölkern ist ein starkes Abnehmen des Brutumfanges, bis hin zur Brutlosigkeit zu beobachten. Die Anzahl Varroamilben steigen in Relation zur Bienenmasse stark an. Der Parasitierungsgrad nimmt zu. Im Küstenbereich und im Emsland sind erste Völkerzusammenbrüche zu verzeichnen, begleitet von Viruserkrankungen in den überlebenden Völkern. Meist sind Imkerfehler in der Varroabekämpfung (kein Drohnenschnitt, wenig Vermehrung) Ursache für die Zusammenbrüche.
Das LAVES rät, wesentlich früher mit der Spätsommerpflege zu starten. Dazu zählt Abernten, Füttern und die Bienenvölker gegen Varroose zu behandeln. Weiter hin ist zu beachten, dass bis zur Einwinterung eine lange Zeit der Milbenreproduktion zu überbrücken ist. Daher sind von August bis Ende November weitere Kontrollen des Varroabefalls und eventuelle weitere Maßnahmen zur Reduktion der Reinvasionsmilben mit zugelassenen Mitteln unerlässlich.
Futtermittel:
Die Qualität der Futtermittel in den Ländern Niedersachsen und Bremen ist in 2006 fortgesetzt hoch gewesen. Es wurden 2.311 Proben gezogen (2005: 2.185). Die Beanstandungsquote über alle untersuchten Parameter lag wie 2005 bei nur 0,8 %, in 2006 entsprach dies 318 Analysen. Insgesamt wurden durch die Futtermittelüberwachung in 78 Verfahren 50.200 € Verwarnungs- u. Bußgelder verhängt(2005: 85 Verfahren mit 44.500 €, 2004: 69 Verfahren mit 40.500 €). Bei Tierhaltern festgestellte Verstöße bezogen sich überwiegend auf Verschleppungen von Kokzidiostatika (Mittel gegen Parasiten) in fertig angelieferten Mischfuttermitteln, in denen diese Zusatzstoffe nicht enthalten sein dürfen. Zurzeit rüsten viele Herstellerbetriebe jedoch ihre Anlagen technisch um, so dass eine Verschleppungsgefahr voraussichtlich nicht mehr auftritt und eine Übertragung von nicht zulässigen Stoffen über die Nutztiere bspw. in Milch, Eiern oder Fleisch ausgeschlossen werden kann. In Niedersachsen sind zwölf Futtermittelkontrolleure im Einsatz. 2006 wurden 2.090 Prüfungen in 1.159 Untenehmen durchgeführt (Betriebs- und Buchprüfungen). (2005: 1.397 Prüfungen, 2004: 1.580 Prüfungen). Der Schwerpunkt der Überwachung liegt auf den gewerblichen Herstellern von Zusatzstoffen, von Vormischungen und von Mischfuttermitteln. Aber auch Hersteller von Einzelfuttermitteln, Händler, Tierärzte und jetzt insbesondere Landwirte werden in die Kontrolle einbezogen. Denn aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben musste die Anzahl der Kontrollen bei Landwirten im vergangenen Jahr verstärkt werden. Das LAVES ist seit 2006 auch für die sog. ,,Cross Compliance"-Prüfungen zuständig. Mindestens 1 % aller Landwirte, die von der EU eine Flächenförderung enthalten, sind im Rahmen einer Risikoauswahl zu kontrollieren, ob sie die futtermittelrechtlichen Vorschriften einhalten. In 2006 waren 589 Betriebe zu prüfen. Es gab nur in 18 Betrieben Beanstandungen, die zu 1 % bis 3 % Abzügen bei den Flächenprämien führten. Durch die Kontrollen bei den Landwirten ist es 2006 auch zu einer Steigerung der Buchprüfungen gekommen, von 135 Prüfungen im Jahre 2005 auf 628 in 2006.
Die Futtermittelüberwachung in Niedersachsen wurde in 2006 weiter entwickelt und verbessert. Das Futtermittelinstitut Stade des LAVES, das die Untersuchungen durchführt, wurde stärker in den Vollzug mit einbezogen und nimmt neben der Analyse der Futtermittelproben auch die futtermittelrechtliche Begutachtung der Untersuchungsergebnisse vor, so dass Prüferkapazitäten für bestimmte Aufgaben freigesetzt wurden.
Futtermittel spielen in niedersächsischer Landwirtschaft zur Versorgung der Tierbestände eine äußerst wichtige Rolle. Die niedersächsische Produktion an Einzelfuttermitteln wie Getreide, Raps oder Grundfutter ist zur Deckung des Bedarfes jedoch nicht ausreichend. Größere Mengen von Rohkomponenten werden aus EU-Staaten und aus Drittländern importiert. Allein über den Hafen Brake wurden 1,3 Mio. t Einzelfuttermittel wie Sojaextraktionsschrot oder Maiskleber aus Übersee eingeführt. Die Sicherheit der hier produzierten Mischfuttermittel ist von hoher Relevanz für die Lebensmittelsicherheit, denn rund 40 % - entsprechend aktuell rund 8 Mio. t – der Mischfuttermittelproduktion in Deutschland entfallen alleine auf Niedersachsen und auf Bremen.
Bedarfsgegenstände
2006 wurden insgesamt 3.383 Bedarfsgegenstände untersucht. Hiervon handelte es sich bei ca. zwei Drittel um Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt (2.071 Proben, davon 182 mit Verstößen). Des Weiteren wurden Gegenstände mit Körperkontakt, kosmetische Mittel, Spielwaren und Scherzartikel sowie Wach- und Reinigungsmittel untersucht (1.312 Proben, davon 73 Proben mit Verstößen).
Ein aktuelles Beispiel: Seit Mitte Januar diesen Jahres ist es verboten, die Weichmacher Di(2-ethylhexyl)phtalat (DEHP), Dibutylphtalat (DBP) und Di-isononylphtalat (BBP) bei der Herstellung und dem Behandeln von Babyartikel-Spielzeug zu verwenden.
Bei diesen Stoffen wurde eine fortpflanzungsgefährdende Wirkung erkannt.
Für Spielzeug und Babyartikel, die von Kindern in den Mund genommen werden können, gilt das Verbot auch für Di-isononylphtalat (DINP), Di-isodecylphtalat (DIDP) und Di-n-octylphtalat (DNOP). Auch diese Stoffe wurden verboten, obwohl eine abschließende wissenschaftliche Risikobewertung noch nicht vorliegt. Mit dem vorsorglichen Verbot wird dem hohen Gesundheitsschutzniveau für Kleinkinder Rechnung getragen. Bei den im Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg des LAVES untersuchten Spielwaren aus Weich- PVC wurden in einer Reihe von Proben diese verbotenen Weichmacher nachgewiesen, insbesondere bei Importprodukten. Da es bei der Herstellerangabe ausreicht, einen Hersteller/Inverkehrbringer in der EU anzugeben, kann nicht in allen Fällen nachvollzogen werden, in welchem Land das Produkt tatsächlich hergestellt wurde.
LAVES: In eigener Sache
Im Rahmen der Verwaltungsreform, Phase II, wurde unter der Federführung des Verwaltungsmodernisierers beim MI (VM / MI) das Reformprojekt "Optimierung landeseigener Laboreinrichtungen" durchgeführt. Für das LAVES führte diese Untersuchung zu dem Ergebnis, dass weitere Synergieeffekte zu realisieren sind, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend gestaltet werden. Hierzu gehören auch abgeschlossene Baumassnahmen an den Standorten Braunschweig, Cuxhaven und Oldenburg. In Braunschweig geht es neben der bereits begonnenen abschließenden Herrichtung eines Institutsgebäudes des Lebensmittelinstituts um weitere kleinere Baumassnahmen im Bestand. In Cuxhaven muss das Institutsgebäude des Instituts für Fischkunde saniert und erweitert werden. In Oldenburg dagegen ist ein Neubau zur Zusammenführung des Veterinärinstituts Oldenburg mit dem Lebensmittelinstitut Oldenburg unter Einbeziehung des Flächenbedarfs für die Zentrale auf dem Gelände des Lebensmittelinstituts geplant. Die Baukosten für die genannten Vorhaben sind zunächst auf ca. 33 Mio. Euro geschätzt worden.
Der Landwirtschaftsminister hat den vorgenannten Baumassnahmen für das LAVES im Rahmen einer Ressort-Abfrage des Finanzministers, welche Baumaßnahmen ab 2009 begonnen werden können, oberste Priorität eingeräumt. Das LAVES ist zuversichtlich, dass bereits in 2009 die ersten Baumassnahmen in Angriff genommen werden können.
Von der Realisierung der Baumassnahmen verspricht sich das LAVES weitere positive Auswirkungen auf den gesundheitlichen Verbraucherschutz in Niedersachsen. Gerade in einem vieh- und nutztierdichten Gebiet, wie dem Oldenburger Land, ist eine stetige Optimierung effizienter Untersuchungsmöglichkeiten anzustreben. Mit dem Neubau der Zusammenführung des Veterinärinstitutes mit dem Lebensmittelinstitut und der Zentrale des LAVES erhält das LAVES einen starken Standort mit moderner Ausrichtung und Ausstattung. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die für Ende des Jahres geplant ist, soll ergeben, ob die genannten, beabsichtigten Baumaßnahmen konkret so umgesetzt werden können.
Für die Untersuchungsaufgaben unterhält das LAVES acht Spezialinstitute an sieben Standorten, in denen die Fachleute Lebensmittel und Futtermittel z. B. auf Kontaminanten oder unerwünschte Stoffe analysieren, in denen aber auch die Tierseuchendiagnostik etabliert ist oder Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel überprüft werden. Zum LAVES zählen die Lebensmittelinstitute Oldenburg und Braunschweig, die Veterinärinstitute Oldenburg und Hannover, das Institut für Fischkunde Cuxhaven, das Futtermittelinstitut Stade, das Institut für Bienenkunde in Celle sowie das Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg. Zudem sind die Dezernate Lebensmittelüberwachung und -kontrolldienst, Tierarzneimittelüberwachung/Rückstandskontrolldienst, Tierseuchenbekämpfung/Tierkörperbeseitigung, Task Force Veterinärwesen, Tierschutzdienst, Futtermittelüberwachung, Ökologischer Landbau, Marktüberwachung und Technische Sachverständige dem LAVES zugeordnet.
Jahresbericht im Internet
Der LAVES-Jahresbericht 2006 erscheint in komprimierter Form. Tätigkeiten und Untersuchungsergebnisse des LAVES sowie Verzeichnisse über die Mitwirkung in Gremien, über wissenschaftliche Vorträge und Veröffentlichungen, über Ringversuche und Laboruntersuchungen sowie über die Teilnahme an Twinning-Projekten finden Sie hier.
 Bildrechte: Land Niedersachsen
Bildrechte: Land NiedersachsenArtikel-Informationen
erstellt am:
23.08.2007
zuletzt aktualisiert am:
11.06.2010

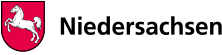

 English
English