 Bildrechte: Land Niedersachsen
Bildrechte: Land NiedersachsenLAVES-Jahresbericht 2004: Landwirtschaftsminister Ehlen spricht von einer ,,erfolgreichen Bilanz“
Presseinformation Nr. 52 vom 24.08.2005
Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) hat sich als zentrale Einrichtung für den gesundheitlichen Verbraucherschutz etabliert: "Weit über 1,6 Millionen amtliche Untersuchungen belegen das", sagte Niedersachsens Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen während der Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des LAVES-Jahresberichts 2004 in Oldenburg und sprach weiter von einer ,,erfolgreichen Bilanz."
Für die Untersuchungsaufgaben unterhält das LAVES acht Spezialinstitute an sieben Standorten, in denen die Fachleute Lebensmittel und Futtermittel z. B. auf Kontaminanten oder unerwünschte Stoffe analysieren, in denen aber auch die Tierseuchendiagnostik etabliert ist oder Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel geprüft werden. Zum LAVES zählen die Lebensmittelinstitute Oldenburg und Braunschweig, die Veterinärinstitute Oldenburg und Hannover, das Institut für Fischwaren und Fischkunde Cuxhaven, das Futtermittelinstitut Stade, das Institut für Bienenkunde in Celle sowie das Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg. Zudem sind die Dezernate Lebensmittelüberwachung und –kontrolldienst, Tierarzneimittelüberwachung, Rückstandskontrolldienst, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Task Force Veterinärwesen, Tierschutz, Tierschutzdienst, Futtermittelüberwachung, Ökologischer Landbau, Marktüberwachung und Technische Sachverständige dem LAVES zugehörig.
Futtermittel-Kontrollen: weniger Beanstandungen
Futtermittel als erster Schritt zur Lebensmittelsicherheit: Die Qualität der Futtermittel in Niedersachsen ist besser geworden. Bei Kontrollen hat es 2004 deutlich weniger Beanstandungen gegeben als im Jahr zuvor. Die Beanstandungsquote sank von 2,5 Prozent auf 1,0 Prozent. In Niedersachsen wird das meiste Futtermittel in Deutschland produziert. 2004 gab es rund 1.600 Prüfungen, 2003 waren es 1.350. Der weitaus größte Teil der Beanstandungen (70 Prozent) waren auf Kennzeichnungsmängel zurückzuführen. Nähere Informationen dazu unter Presseinformation Nr. 47: "Futtermittelüberwachung in Niedersachsen" – positive Bilanz für 2004."
Fleischuntersuchungen
In den vergangenen Monaten stand das Lebensmittel Fleisch wiederholt im Medieninteresse. Zuletzt ging es um den Vorwurf der Umetikettierung von abgelaufener Ware. Das LAVES plant kurzfristig ein Sonderprogramm zur Überprüfung der Hygiene beim Verarbeiten und Inverkehrbringen von Fleisch. Die Prüfungen sollen in mehreren ausgewählten Landkreisen durchgeführt werden. Relevant sind Betriebe, in denen Hackfleisch und Frischfleisch abgepackt, umgepackt, bzw. als lose Ware angeboten wird.
2004 wurden in den Lebensmittelinstituten Oldenburg und Braunschweig knapp 6.000 Proben Fleisch, Fleischerzeugnisse und Wurstwaren untersucht, davon wurden rund 2.000 Proben beanstandet.
Schwerpunkt bei den Beanstandungen sind Kennzeichnungsmängel - sowohl bei loser Abgabe als auch bei Fertigpackungen. Oftmals fehlt die Angabe verarbeiteter Zusatzstoffe, bei Fertigpackungen fehlen Haltbarkeitsangaben, Mengenangaben und Nährwertangaben.
Auffällig war der hohe Anteil an sog. "Wertminderungen", dazu zählen beispielsweise unzulässig hohe Wasserzusätze, zu geringe Grobfleischeinlagen bei Bierschinken, Rotwürsten und Aspikerzeugnissen sowie die Verarbeitung von minderwertigem Fleisch und zuviel Fett.
Bei Kochpökelerzeugnissen sowohl vom Schwein als auch vom Geflügel ist seit Jahren ein deutlicher Qualitätsverlust zu verzeichnen. Bei rund 72 % (21 von 29 Proben) der als "Hähnchenbrustfilet" oder "Putenbrustfilet" als Aufschnitt in den Verkehr gebrachten Proben gab es Beanstandungen, da das Fleisch aus Stückchen zusammengefügt worden war.
Wurstwaren aus Geflügelfleisch werden nach wie vor unter Verarbeitung von Separatorenfleisch ("Restfleisch", das maschinell von grob ausgelösten Knochen getrennt wird) herstellt. Bei ca. 16 % der daraufhin untersuchten Proben war der Gehalt an Knochenpartikeln überhöht, die Proben wurden beanstandet.
Gleichbleibend hohe Beanstandungsquoten gibt es darüber hinaus wegen zu lang bemessener und somit irreführender Haltbarkeitsangaben bei Brühwurst in Scheiben (ca. 30 %), bei Brühwürstchen (ca. 46 %), bei Kochpökelerzeugnissen in Scheiben (ca. 55 %) und bei Rohschinken in Scheiben (ca. 31 %).
Wasserzusätze in Fleisch und Fisch – Verbraucher kauft ,,Wasser" mit
Im Lebensmittelinstitut Oldenburg (LI OL) wurden Hähnchen-Nuggets auf ihren Fleischanteil hin untersucht. Dabei stellten die Experten fest, dass bei der Mehrzahl der untersuchten Proben deutlich weniger Fleisch verarbeitet wurde als auf der Verpackung angegeben worden war; häufig lag der Fleischgehalt unter 90 % des deklarierten Gehaltes. Die Ursache liegt zum einen in einem höheren Panadeanteil, zum anderen an einem hohen Anteil an in Form von "Flüssigwürzung" zugefügtem Wasser. Hähnchen-Nuggets setzen sich aus Fleisch, Flüssigwürzung und Panade zusammen. Daraus ergibt sich, dass bei weniger Fleisch in den Nuggets mehr Wasser (Flüssigwürzung) und/oder mehr Panade enthalten sein muss – beides Produkte, die deutlich billiger sind als Hähnchenfleisch.
Polyphosphate wurden zudem in Fischereierzeugnissen nachgewiesen, wie zum Beispiel in Tiefkühlfischfilets, in Fischstäbchen und in Shrimps. Bei 32 von 255 untersuchten Proben wies das Institut für Fischkunde in Cuxhaven Polyphosphat-Zusätze nach. Mit Polyphosphaten lassen sich nicht nur Abtropf-Wasserverluste beim Auftauen verhindern, sie können missbräuchlich auch die Einbindung von Fremdwasser in das Muskelgewebe der Fischprodukte bewirken. Der Fisch wird durch den "Mitverkauf von Wasser" schwerer und damit teurer.
Salmonellen
2004 wurden 5.115 Lebensmittel auf Salmonellen untersucht, 71-mal konnten Salmonellen nachgewiesen werden. Infektionen durch Salmonellen sind in Deutschland nach wie vor die am häufigsten erfasste Ursache von Durchfallerkrankungen. Als Ursache kommen sehr oft vom Tier stammende Lebensmittel infrage, wobei die Infektion nicht nur durch den Verzehr von salmonellenhaltigen Lebensmitteln, sondern auch durch die Verbreitung auf andere Lebensmittel während der Zubereitung erfolgt. Die meisten positiven Ergebnisse (ähnlich wie in den Vorjahren) wurden bei Fleisch und Produkten aus Fleisch gefunden, nämlich 63. 43-mal wurden Salmonellen in Schweinefleisch oder Erzeugnissen aus Schweinefleisch nachgewiesen. Obwohl die Belastung bei Geflügelfleisch höher liegt, stellt die hohe Nachweisrate bei Produkten aus Schweinefleisch ein höheres Risiko für den Verbraucher dar, da es sich im Gegensatz zu Geflügelfleisch, das in der Regel erhitzt gegessen wird, hier auch um direkt zum Verzehr vorgesehene Erzeugnisse wie Thüringer Mett oder frische Mettwurst handelt. Auch pflanzliche Lebensmittel wie Gewürze, getrocknete Pilze oder Kräutertees können Salmonellen enthalten, die unter ungünstigen Umständen zu einer Infektion führen können. In 2004 wurden Salmonellen 8-mal aus pflanzlichen Produkten isoliert.
Positiv: Im Berichtsjahr wurden 331 Ei-Proben auf Salmonellen überprüft, darunter waren auch drei Proben rohe Wachteleier. Bei keiner Probe waren Salmonellen nachweisbar.
BSE
Die Rinderkrankheit BSE bleibt Thema: In diesem Jahr sind in Niedersachsen zwei BSE-Fälle gemeldet worden, seit Bekannt Werden des ersten deutschen BSE-Falles (2000) sind damit in Niedersachsen insgesamt 68 BSE-Fälle registriert.
Laut EU-Verordnung sind BSE-Untersuchungen bei allen über 30 Monate alten für den menschlichen Verzehr geschlachteten Rindern Pflicht. Alle über 24 Monate alten Rinder, die verendet sind, not- oder krankgeschlachtet werden, müssen ebenso untersucht werden. In Deutschland werden über das EU-Recht hinaus über 24 Monate alte und alle verendeten Rinder auf BSE getestet. Inzwischen haben sich die eingeleiteten Bekämpfungsmaßnahmen als wirkungsvoll erwiesen, so dass in Deutschland die Anhebung der Altersgrenze für BSE-Tests bei Schlachtrindern von 24 auf 30 Monate diskutiert wird.
Schafe und Ziegen unterliegen bisher keiner flächendeckenden Untersuchung auf TSE. Seit BSE bei Rindern festgestellt wurde, gibt es jedoch ein stichprobenartiges Kontroll- und Überwachungssystem für die Traberkrankheit und für BSE bei Schafen und Tieren (TSE). In den Veterinärinstituten Oldenburg und Hannover wurden 2004 rund knapp 210.000 TSE-Untersuchungen durchgeführt. Dabei beträgt der Anteil der Rinderuntersuchungen 95,8 %. Insgesamt gab es im Jahr 2004 neun bestätigte BSE-Fälle bei Rindern und acht TSE-Fälle bei Schafen.
Campylobacter-Monitoring-Projekt bei Masthähnchen
Campylobacter-Bakterien sind neben Salmonellen die häufigste Ursache lebensmittelbedingter Durchfallerkrankungen beim Menschen. Durch den Verzehr von Rohmilch kann es zu Erkrankungsfällen kommen, aber auch Geflügel gilt als wichtigster Überträger dieser Bakterien (Übertragungsweg auf den Menschen z. B. durch unzureichend erhitztes Geflügelfleisch). Die Veterinärinstitute Hannover und Oldenburg beteiligen sich an einer bu-desweit durchgeführten Studie, die das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Berlin, organisiert hat. Dabei geht es um die Ermittlung des Vorkommens von Campylobacter-Bakterien bei Masthähnchen. Untersucht wurde der Blinddarminhalt von Masthähnchen aus fünf niedersächsischen Geflügelschlachtbetrieben. Das Monitoring-Programm dauert 2005 noch an, da die Untersuchungen u. a. Aussagen zu möglichen jahreszeitlichen Schwankungen des Erregervorkommens liefern sollen und damit Probenahmen im Sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) sowie im Winterhalbjahr (ab November) erforderlich machen. Bislang wurden insgesamt 614 Poolproben von je zehn Tieren einer Herde untersucht. In 295 Proben (48 %) wurden Campylobacter-Bakterien nachgewiesen.
Vergiftung von Zugvögeln durch Pestizide und PCBs
In das Veterinärinstitut Oldenburg wurden wiederholt Stare eingesandt, die tot unter Bäumen oder Überlandleitungen aufgefunden worden oder plötzlich von den Ästen gefallen waren. Festgestellt wurde bei den Untersuchungen, dass die Tiere infolge schwerer Verletzungen und innerer Blutungen sterben mussten. Bei der Suche nach der Ursache wiesen LAVES-Experten bei den Vögeln in einem Fall Pflanzenschutzmittel (Dieldrin, DDT) und in einem anderen Fall PCBs (polychlorierte Biphenyle) in sehr hohen Gehalten nach.
Die Wissenschaftler nehmen an, dass eine Vergiftung mit diesen Substanzen Ursache des Vogelsterbens sei. Die Aufnahme der Stoffe erfolge höchstwahrscheinlich in den Winterquartieren (vorwiegend südlicher Mittelmeerraum bis südliches Afrika). Die Vögel speichern die schwer abbaubaren Gifte im Fettgewebe an, um für den Rückflug in die Brutgebiete ausreichend versorgt zu sein. Diese Fettdepots werden in einem relativ kurzen Zeitraum in erheblichem Maße abgebaut. Dadurch werden die enthaltenen Pestizide/PCBs in großen Konzentrationen freigesetzt, die Vögel akut vergiftet. Ausfallerscheinungen des Nervensystems (Übererregbarkeit, ungeordnete Bewegungen, Krämpfe etc.) sind die Folge. Die Vögel stürzen von Rast- und Schlafplätzen ab. Während in Deutschland und der EU der Einsatz von Pestiziden und PCBs streng reglementiert ist, gilt dies nicht für andere Länder.
Vogelgrippe
In den vergangenen Jahren ist es weltweit zu einer beträchtlichen Ausweitung der sog. Vogelgrippe gekommen. Seuchenausbrüche haben sich insbesondere in Ost- und Südostasien gehäuft, aber auch auf Russland und Kasachstan hat sich die Seuche ausgeweitet. Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, verhängte die EU ein Importverbot für Geflügel, Geflügelprodukte und Vögel aus Russland und Asien. Aus Angst vor einem Übergreifen der Vogelgrippe auf Deutschland will die Bundesregierung die Freilandhaltung von Geflügel verbieten. Die Schutzmaßnahmen sollten spätestens zum 15. September greifen, falls das Virus dann westlich des Urals sei, so das Bundesministerium für Verbraucherschutz.
Nachweise von H5-bzw. H7-Viren, die eine Vogelgrippe auslösen können, wurden vor allem bei Wildvögeln geführt, auch in einer Reihe europäischer Länder, darunter auch in Deutschland. In Niedersachsen fand 2004 ein von der EU kofinanziertes Geflügelpestmonitoring statt. Ziel war es, anhand des Nachweises von Antikörpern gegen H5- bzw. H7-Viren einen Überblick über möglicherweise stattgefundene Viruskontakte zu erhalten. Einbezogen waren vorzugsweise - eventuell wildvögelexponierte - Freilandhaltungen, überwiegend in den geflügeldichtesten Landkreisen Niedersachsens. Von Experten des Veterinärinstituts Oldenburg (VI OL) wurden (in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalen Referenzlabor für aviäre Influenza des Bundesforschungsinstitutes für Tiergesundheit, Insel Riems) 1.473 Sera von Hühnern, 834 von Puten, 2.347 von Enten und 1.759 von Gänsen auf Antikörper getestet. In einem kleinen Gänsebestand wurden H7-Antikörper ermittelt, die zur Räumung des Bestandes und zu umfangreichen weiteren Untersuchungen führten. Auf Beschluss der EU-Kommission gibt es auch in diesem Jahr ein erneutes, EU-weites Geflügelpestmonitoring. Das VI OL wird daran teilnehmen.
Niedersachsen hat Vorbildcharakter bei der Tierseuchenbekämpfung: Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit war nicht allein im Berichtsjahr Thema, sondern Maßnahmen dazu wurden in diesem Jahr konkretisiert, denn die Tierseuchenbekämpfung soll auf europäischer Ebene fortentwickelt werden. Dazu soll die Zusammenarbeit in den grenznahen Regionen von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden vertieft werden. So soll es zum Beispiel zur besseren Vorbereitung auf künftige Krisenfälle eine stärkere Zusammenarbeit auf allen Gebieten des Krisenmanagements geben. Hierzu wird es vom 15. bis zum 17. November auf niedersächsischer Seite eine mehrtägige gemeinsame Tierseuchenübung geben, in die alle Ebenen der Veterinärverwaltung einbezogen werden: von niedersächsischer Seite aus das Landwirtschaftsministerium, das LAVES sowie die beteiligten Landkreise Emden, Leer, Wesermarsch, Aurich und Ammerland.
Niedersachsen entwickelt Rinderhaltungs-Leitlinien
Bisher fehlen EU-weit Vorgaben über die tierschutzgerechte Haltung von Rindern. Niedersachsen hat in diesem Bereich jetzt Vorbildfunktion: Das Tierschutzdezernat des LAVES erarbeitete im Berichtsjahr gemeinsam mit Landwirtschaftskammern, Verbänden, Vertretern der Wissenschaft und Amtstierärzten entsprechende Leitlinien zur Milchkuhhaltung. Die Leitlinien sollen einerseits Behörden und Tierhalter eine Handhabe geben – z. B. bei der tierschutzfachlichen Beurteilung von Stall-Neu- und Umbauten. Andererseits ist die Leitlinie als für bestehende Rinderhaltungen als Leitlinie gedacht. 2005 laufen die Planungen für ein entsprechendes Pendant für die Mastrinderhaltung.
Bundesweit einmaliges Pilotprojekt ,,Masthähnchen"
Als Grundlage für eine optimale Tierhaltung hat die Europäische Kommission in einer Richtlinie zum Schutz vor Masthühnern erstmals ein ,, gutes Management" in ihrem Entwurf mit aufgriffen. Bereits 2003 hatte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium gemeinsam mit der niedersächsischen Geflügelwirtschaft ein Pilotprojekt vereinbart – unter Federführung des Tierschutzdezernats. Danach soll festgelegt werden, was unter einer ,,guten Tierhaltungspraxis" zu verstehen ist. Das Projekt umfasst sowohl Untersuchungen zur Tiergesundheit am Schlachthof als auch die Auswertung managementspezifischer Informationen aus den Mastbetrieben. Gleichzeitig wird eine Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Tiergesundheit erarbeitet. Die Ergebnisse dieses bundesweit einmaligen Projektes werden in diesem Jahr in die Beratungen des Richtlinienentwurfs auf EU-Ebene einge-bracht.
Furan in Säuglingsnahrung
Das Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg (IfB LG) hat im Rahmen einer Datenerhebung verschiedene Lebensmittel (60 Proben) auf ihren Gehalt an Furan hin untersucht. Zu den untersuchten Produktgruppen gehörten Säuglings-/Kindernahrung und Eintopfgerichte (überwiegend von in Niedersachsen ansässigen Herstellern), Kondensmilch, Knabbererzeugnisse sowie Grill- und Würzsoßen. Der höchste Furangehalt mit 61 µ/kg wurde in einer Säuglingsnahrung (Nudeln mit Gemüse) festgestellt, die niedrigsten Gehalte von 3 µ/kg in einem Gemüsesaft für Kinder und in einem Kondensmilcherzeugnis. Eindeutige Korrelationen zwischen Art bzw. Zusammensetzung der Erzeugnisse und jeweiliger Höhe des Furangehaltes lassen sich bei den untersuchten Produktgruppen nicht erkennen. Furan ist eine leichtflüchtige, in Wasser unlösliche Verbindung, die sich in Tierversuchen als krebserregend erwiesen hat. Die Datenlage zur Toxizität von Furan insbesondere für den Menschen ist allerdings unvollständig.
Über die Entstehung von Furan liegen bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.
Substanzen mit hormonartiger Wirkung in Mineral- und Tafelwässer
Seit Jahren ist Wissenschaftlern bekannt, dass eine Vielzahl von Substanzen, die in Lebensmitteln und Wasser vorhanden sein können, hormonhaltige (estrogene) Wirkungen besitzen. Im Lebensmittelinstitut Braunschweig (LI BS) wurde daher ein biologisches Testsystem etabliert, um estrogene Wirksamkeit nachweisen zu können. Im LI BS wurden Proben von Trink-, Mineral- und Tafelwässer untersucht. Von 37 untersuchten Mineral- und Tafelwässer wurde in sieben Proben Substanzen mit estrogenen Wirkungen nachgewiesen. Sie befanden sich in PET-, bzw. Kunststoff-Flaschen. Eine weitere Probe aus einer Grünglasflasche enthielt ebenfalls diese Substanzen. Alle sieben Proben von Trinkwasser waren in Ordnung.
Das LI BS überprüft jetzt durch weitere Untersuchungen der betroffenen Proben, ob die Wässer selbst oder Stoffe aus den Verpackungen für die estrogene Wirksamkeit verantwortlich sind.
Antibiotika-Rückstände in Honig
Bis auf eine Ausnahme durchweg gute Ergebnisse für Honig aus Niedersachsen: Im Veterinärinstitut Hannover (VI H) und im Lebensmittelinstitut Braunschweig (LI BS) wurden im Berichtsjahr 48 niedersächsische Honige auf Antibiotika und Sulfonamide untersucht. Dabei wurde eine Probe aufgrund von Spuren an Tetracyclinen beanstandet. Weitere von diesem Imker untersuchte Proben waren jedoch rückstandsfrei. Bei einer Probe aus einem anderen Betrieb wurde Sulfamethoxazol, eine Substanz aus der Stoffgruppe der Sulfonamide nachgewiesen. Auch in diesem Betrieb wurden Nachproben gezogen, die sich derzeit in der Untersuchung befinden. Parallel zu dieser flächendeckenden Untersuchung wurden risikoorientiert Betriebe beprobt, bei denen in vorangegangenen Untersuchungen eine bestimmte Belastung mit Sporen des Erregers der Amerikanischen Faulbrut festgestellt wurde. Diese bakterielle Erkrankung der Bienen wird in Drittländern häufig mit Antibiotika und Sulfonamiden behandelt. Im VI H wurden in diesem Abschnitt des Sonderprogramms 18 Proben auf Streptomycin, Tetracycline, Sulfonamide und Trimethoprim untersucht. Es konnte keiner der genannten Stoffe nachgewiesen werden. Der Honigkonsum in Deutschland liegt bei ca. 95.000 t jährlich. Da nur ca. 25.000 t in Deutschland produziert werden, muss ein Großteil des Honigs importiert werden. Im Gegensatz zu Deutschland ist es in einigen Drittländern auf den Kontinenten Amerika, Asien und Europa erlaubt, gegen drohende Krankheiten bei Bienenvölkern Tierarzneimittel anzuwenden. Dadurch ist die Gefahr der Bildung von Rückständen in Bienenprodukten, insbesondere Honig, verbunden. Insbesondere im Hinblick auf den vorbeugenden Verbraucherschutz gilt in Deutschland bei Honig für Rückstände von Antibiotika die Null-Toleranz.
Gentechnisch veränderte Pflanzen – Erweiterung der Untersuchungen auf Futtermittel
Gentechnisch veränderte Pflanzen – ein aktuelles Thema für die amtliche Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, denn im September 2003 wurde die Grundlage für die verbindliche Rückverfolgbarkeit von gentechnisch veränderten Organismen geschaffen. In zwei 2003 verabschiedeten EU-Verordnungen (EG Nr. 1829/2003 und EG Nr. 1830/2003) wurde die Grundlage für die Kennzeichnungspflicht von gentechnisch veränderten Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und Futtermitteln neu definiert, da seitdem das Herkunftsprinzip gilt: die Kennzeichnungspflicht ist nun unabhängig vom Nachweis von gentechnisch veränderten Stoffen. Bildete bis 2003 die Nachweisbarkeit von Stoffen aus gentechnisch veränderten Organismen (GVO) die Grundlage, so gilt jetzt, dass ein Lebensmittel grundsätzlich kennzeichnungspflichtig ist, wenn es GVO enthält, aus diesen besteht, aus GVO hergestellt wurde oder Zutaten enthält, die aus GVO hergestellt wurden. Zudem wurde der Geltungsbereich auf Futtermittel erweitet.
Das LAVES hat auf diese Neuerung durch die Erweiterung des Untersuchungsspektrums reagiert und die Futtermittel in das Routinespektrum der Analytik aufgenommen. Bei einem Futtermittelmonitoring wurden 146 Futtermittelproben auf Erbmaterial aus gentechnisch veränderten Pflanzenlinien von Soja, Mais und Raps untersucht. Untersucht wurden zudem 560 Lebensmittelproben und 190 Saatgutproben, wobei das LAVES seit 2004 diese Untersuchungen auch für das Land Bremen durchführt. Von folgenden Lebensmitteln wurden Proben gezogen: Sojaeis, Desserts auf Sojabasis, Sojadrinks, Sojaölkapseln, Lecithin, Knabbergebäck, Müsliriegel, Fertigsuppen, Fleischwaren, Getreideprodukte, Nudelsoßen, vegetarische Brotaufstriche und Bratlinge, Tofu und Tofuerzeugnisse, Fertiggerichte, Nussnougat-Cremes, Schokoladenwaren, Säuglings- und Kleinkindnahrung, Frischeiwaffeln, Senf, Diätnahrung, Brot, Popkorn, Maisgrieß- und mehle, Zuckermais, Papayas. Bei 43 Proben wurden gentechnisch veränderte Bestandteile aus der gentechnisch veränderten Sojabohne nachgewiesen, davon wiesen drei Proben einen Gehalt größer als 0,9 % (dem 2004 gültigen Schwellenwert für eine vorgeschriebene Kennzeichnung) an gentechnisch veränderter DNA bezogen auf den Sojaanteil in der Probe auf. In 20 Proben, die auf Bestandteile von GVO-Papaya untersucht wurden, konnte keine gentechnische Veränderung nachgewiesen werden.
Kosmetik: Beanstandungen rückläufig
Insgesamt waren 2004 1.641 Proben kosmetische Mittel untersucht worden, 106 Proben mussten beanstandet werden. (2003: 1.626 untersuchte Proben, 151 Beanstandungen). Damit bleibt die Zahl der Beanstandungsquote - wie in den Jahren zuvor - weiter rückläufig. Mängel gab es überwiegend im Kennzeichnungsbereich (fehlende Chargennummer oder falsche Inhaltsstoffangabe, fehlende Angabe von Warnhinweisen). Stoffe, die nicht zur Herstellung kosmetischer Mittel verwendet dürfen, wurden ausschließlich in Waren nachgewiesen, die nicht in der EU produziert wurden. Die Proben wurden in Asia- oder Afroshops gezogen. Insgesamt gab es 17 Beanstandungen. Kosmetische Mittel osteuropäischer Herkunft wiesen in Gesichts- bzw. Rassierwässer den verbotenen Farbstoff Metanilgelb auf; auch der verbotene Duftstoff Moschus Ambrette konnte in russischem Duftwasser festgestellt werden. Bei den mikrobiologischen Untersuchungen wurden vorwiegend Keime nachgewiesen, die auf unzureichende hygienische Verhältnisse schließen lassen. Kein Produkt wurde aufgrund mikrobiologischer Kontamination als gesundheitsschädlich beurteilt.
Scoubidoubänder: fehlende Warnhinweise und Kennzeichnungsmängel
Scoubidoubänder – beworben als kreativer Bastelspaß für Erwachsene und Kinder – haben sich als außerordentlich gefragte Produkte erwiesen. Daher wurden im Institut für Bedarfsgegenstände Lüneburg (IfB LG) 17 Scoubidoubänder untersucht. Die Inhaltsstoffe der Bänder waren nicht zu beanstanden. Es gab jedoch keine einheitliche Kennzeichnung der Bänder. Das IfB LG ordnet die Bänder als Spielware ein. Da der Umgang (z. B. das Flechten eines Tieres) technisches Geschick erfordert, sind diese Erzeugnisse für Kinder über drei Jahren bestimmt. Hier sind insoweit eindeutige Warnhinweise zu fordern. Bei rund 50 % der Proben entsprach die Aufmachung und Kennzeichnung der Scoubidou-Bänder nicht den Anforderungen der Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug.
Der Jahresbericht steht Ihnen hier als Download zur Verfügung.
 Bildrechte: Land Niedersachsen
Bildrechte: Land Niedersachsen
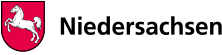

 English
English